Christina von Braun & Tilo Held: Kampf ums Unbewusste
Seit einigen Monaten lese ich zum »Herunterkommen« neben der eigenen Arbeit (eher: vor und nach) ein Buch nach dem anderen, das thematisch nichts mit meinem Thema, die Family Affairs der Booles, Taylors und Hintons, zu tun hat. In dieser kleinen Serie blicke ich auf einen Teil dieser Lektüre zurück.
Von den 730 Seiten hat Christina von Braun 498 geschrieben, ihr Mann Tilo Held 137, und 93 Seiten sind Anmerkungen und Register.
Die ersten 200 Seiten sind sehr erhellend. In ihnen wird beschrieben, wie in der Geistesgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts das Unbewusste an die Stelle Gottes rückte – und welche Ausgestaltungen das Unbewusste vor Freud und dann durch ihn und seine Zeitgenossen erlebte. Sie erfindet ein Gegensatzpaar – Glauben vs. Vertrauen –, deren Elemente sie wahlweise verschiedenen theoretischen Ausformungen zuordnet. Das funktioniert weitgehend gut mit dem Glauben, aber nach meinem Eindruck oft gar nicht gut mit dem Vertrauen.
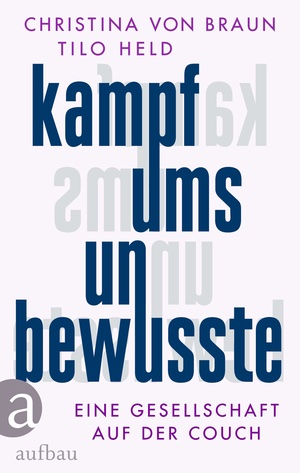
Durch die historischen Kapitel bin ich CvB gern gefolgt, mit kleinen Einwänden zu ihren Äußerungen über den Film. Zum Beispiel unterstellt sie Sergei Eisenstein (mit Alexander Etkind, der eine Geschichte der Psychoanalyse in Russland geschrieben hat), er habe die Werke von Sigmund Freud gelesen, nur um sein Filmpublikum perfekt manipulieren zu können. Zu guter Letzt stellt sie Eisenstein auch noch auf eine Stufe mit Leni Riefenstahl. Einige Blicke in die Eisenstein-Biographie von Oksana Bulgakowa hätten genügt, um etwas über Eisensteins Vortrag am Berliner Psychoanalytischen Institut über die »Ausdrucksbewegung« zu erfahren. Er hielt den Vortrag im Oktober 1929 auf Einladung des Institutsdirektors Hanns Sachs. In seiner Theorie der Ausdrucksbewegung geht es ihm um den Konflikt zwischen Triebäußerung und der hemmenden Kraft des Willens und nicht um Massenagitation.
Interessant sind einige Aspekte der Nachkriegszeit, in der die Psychoanalyse sich in einzelne Provinzen teilte: In den USA wurde sie der Medizin zugeschlagen und erfuhr eine Art Christianisierung, in Frankreich verband sie sich mit der Sprachphilosophie und dem Strukturalismus. In Deutschland trat sie die vorher vorhandenen sozial- und kulturkritischen Perspektiven an die Geisteswissenschaften ab.
Im sechsten Kapitel, das den Massenmedien gewidmet ist, wird es dann ziemlich schlimm. »Medien vernetzen nicht nur auf bewusster Ebene, sie formatieren auch das individuelle und kollektive Unbewusste.« So heißt es auf Seite 356, und eine Begründung dafür ist offenbar unnötig. Dass die technischen Medien an der Formung von Gedanken »mitarbeiten«, ist seit Nietzsches Bonmot über sein »Schreibzeug« eine gängige Vermutung. In welcher Weise allerdings Medien auf das Unbewusste einwirken können, wüsste man dann doch gern.
Gustave Le Bon hält CvB, der von Nazis gern gelesen und zitiert wurde, nach wie vor für aktuell: »Le Bons Aktualität verdankt sich nicht nur der Tatsache, dass er die Diktaturen des 20. Jahrhunderts vorausahnte (gegebenenfalls auch modellieren half), sie bietet auch einen Schlüssel zum Verständnis heutiger Verhältnisse (…) Die Masse, so schrieb Le Bon, sei unfähig, ›Meinungen zu haben außer jenen, die ihnen eingeflößt wurden; Regeln, welche auf rein begrifflichem Ermessen beruhen, vermögen sie nicht zu leiten. Nur die Eindrücke, die man in ihre Seele pflanzt, können sie verführen‹. Das sind Aussagen, die sich auch auf viele aktuelle Situationen und technische Neuerungen übertragen lassen.« (380)
Auch mit ihrer Definition der KI vergreift sie sich: »Es handelt sich um ein in Software geladenes neuronales Netzwerk, für das die Biologie Modell stand, das jedoch nicht über die Lernfähigkeit unserer neuronalen Systeme verfügt.« (412) Die Nobelpreise 2024 an Geoffrey Hinton und John Hopfield (Physik) sowie Demis Hassabis (Chemie) gingen gerade an Wissenschaftler, die mit ihren Systemen die Lernfähigkeit künstlicher neuronaler Systeme (Deep Learning) demonstriert haben. Und nicht umsonst warnt Geoffrey Hinton davor, dass KI-Systeme schon in wenigen Jahren »besser« sein können als Menschen und wir daher unsere Beziehung zu diesen Systemen neu ordnen müssten.
Den Teil von Tilo Held habe ich dann nicht mehr gelesen. Zur Typographie: Ich mag ja die Syntax Serif von Hans Eduard Meier, aber hätte eine etwas geringere Punktgröße gewählt. Nur durchschnittlich 1.650 Zeichen pro Seite machen das Buch zwar dick, aber wirklich lesefreundlich sind die Seiten nicht.
Christina von Braun und Tilo Held: Kampf ums Unbewusste. Eine Gesellschaft auf der Couch. Berlin: Aufbau, 2025.