Der Plot ist nicht sonderlich verwickelt. Eine querschnittgelähmte junge Frau, die viel im Rollstuhl herumfährt, gerät in Wien in eine philosophische Guerilla-Gruppe. Zur Gruppe gehören:
- Bernward, ein ehemaliger Philosophiedozent,
- eine schon ältere Frau, die auch Philosophie studiert hat, vor Jahrzehnten mit der deutschen RAF sympathisierte, sich mit Sprengstoff auskennt und jetzt »Chirurgin« genannt wird,
- Paul, ein ehemaliger Student des Dozenten,
- Brigitte, eine Unternehmertochter.
Die Gruppe, die sich den Namen Aletheia (Wahrheit) gegeben hat, will die verlorene Wahrheitsorientierung in der Gesellschaft wiederherstellen. Über das Buch verstreut sind nummerierte Absätze aus einem Manifest. In diesem wird die in der kontinentalen Philosophie des 20. und 21. Jahrhunderts – im Einklang mit den Erkenntnissen der Neurophysiologie – stattgefundene Infragestellung einer objektiven, verbindlichen und für alle gültigen Wahrheit attackiert.
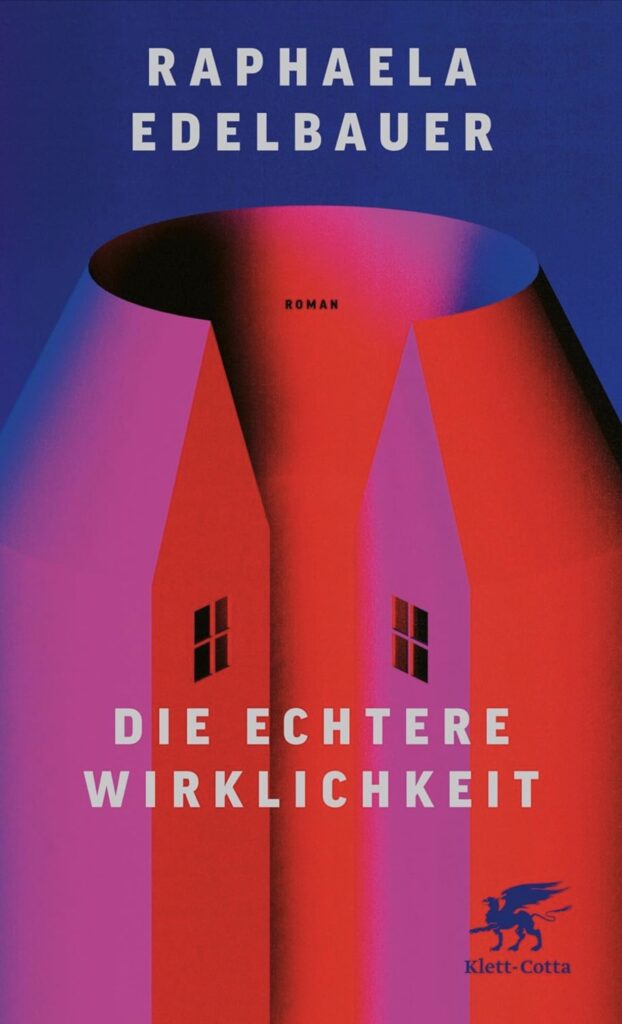
Die Protagonistin und Ich-Erzählerin wird nach einer längeren Probezeit in die Gruppe aufgenommen. An einer Aktion, bei der die Bürotür eines Philosophieprofessors in der Universität dilettantisch zugemauert wird – um ihn auf eine »echte« Wirklichkeit hinzuweisen –, nimmt sie noch nicht teil, dann aber an der Planung eines größeren Anschlags und einer Geiselnahme.
Die Erzählerin heißt Petra, nennt sich Byproxy und hat nach ihrem Abitur begonnen, Spiele zu programmieren. By proxy ist im klinischen Sinne eine Erscheinungsform des Münchhausen-Syndroms: Eine Person (zum Beispiel eine Mutter) redet ihrem Kind eine Krankheit ein und erzeugt diese möglicherweise sogar durch Medikamente und Gifte, um dann die Behandlung zu übernehmen. Es ist also eine psychopathologische Störung, an der immer mindestens zwei Personen beteiligt sind.
In den Rollstuhl geriet Byproxy durch einen Unfall noch während der Schulzeit, als sie mit ihrer psychisch labilen Freundin Dorothee (die eine noch labilere Mutter hat) ein Austauschjahr in Schweden verbrachte. Die Beziehung der Freundinnen, die in ihrem sechsten Lebensjahr begann, wird in unregelmäßig einmontierten Kapiteln nachgereicht. Als Vorgeschichte der aktuellen Erzählung kann dieser Erzählstrang nur insofern bezeichnet werden, als er eine Erklärung des folgenreichen Unfalls der Protagonistin gibt.
Die Kapitel sind jeweils mit einem Kleinbuchstaben aus dem griechischen Alphabet überschrieben. Dabei wird jedoch nicht die alphabetische Reihenfolge eingehalten, so dass man versucht sein könnte, das als Aufforderung zu einer Neusortierung des Textes bei der Lektüre zu verstehen, also mit dem 3. Kapitel zu beginnen, dann das 9, das 15., 17., 11. usw. zu lesen. Insgesamt gibt es 24 Kapitel und einen Epilog. Ich habe die alphabetische Reihenfolge getestet, sie ergibt keinen Gewinn im Sinne einer zusätzlichen Erkenntnis zum Erzählstoff (das ist bei Cortázars Rayuela anders).
Das By proxy-Syndrom könnte als übergreifendes Modell für die Absichten und Handlungen der Romanfiguren verstanden werden. Sie wollen »der Gesellschaft« eine Krankheit einreden, die nur durch radikale Maßnahmen geheilt werden kann. Diese Heiler gibt es ja tatsächlich zuhauf, sie sind keine Untergrundgruppen, sondern sie geben in Politik, Kultur und Medien den Ton an und wollen ihr Verständnis von Wahrheit und Wirklichkeit verbindlich machen.
Ob Raphaela Edelbauer diese Interpretation teilt, weiß ich nicht, aber mir drängt sie sich auf. Ihr scheint ein anderes Erzähl- und Verständnismuster wichtig zu sein: das »Think-Backwards-Spiel«. Zum Beispiel wird ein Kriminalfall durch schrittweises Zurückgehen in die Vergangenheit aufgeklärt. Das Anfangskapitel gehört in der Ereignischronologie des Romans unmittelbar vor die Darstellung der dramatischen Hauptaktion, die allerdings noch über 300 Seiten entfernt ist. Kann man machen, aber ist hier ein eher belangloses spielerisches Element – danach wird ja letztlich doch chronologisch erzählt. Auf über 400 Seiten; eine größere Verdichtung hätte dem Buch gut getan.
Raphaela Edelbauer: Die echtere Wirklichkeit. Stuttgart: Klett-Cotta, 2025.
Besprechung von Raphaela Edelbauers Buch Die Inkommensurablen.