Christoph Engemann beobachtet und beschreibt seit vielen Jahren Besonderheiten der digitalen Medienwelt – spontan erinnere ich mich an Themen wie digitale Identität, die »Verschränkung« von Maschinen und Körpern und das von ihm in die Diskussion über digitale Netzwerke und Plattformen eingebrachte Stichwort »Graphennahme«. Bei letzterem geht es um die Datenstrukturen, die in Netzwerken jeden einzelnen Nutzer und jede einzelne Aktion als dynamische Relation aufzeichnen, um sie für die Plattform-Betreiber, also Graphen»nehmer«, kommerziell und für andere Zwecke nutzbar zu machen. Die ersten Leser aller Schreibakte auf einer Plattform sind die graphengenerierenden Maschinen. Schreibakte sind dabei jedoch nicht nur schriftliche Hervorbringungen von menschlichen Individuen, sondern auch Audio- und Videoströme, die automatisch und hinter dem Rücken der Akteure in Texte übersetzt werden – und manchmal als automatische Transkripte z. B. bei Youtube auch für Nutzer sichtbar werden.
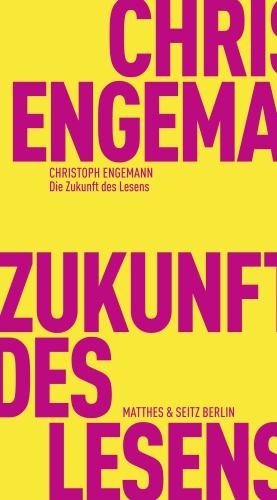
Das zentrale neue Schlagwort des Buchs ist die »Plattform-Oralität«. Beschrieben wird damit der Übergang vom Schreibzeug (das Dispositiv Schreibmaschine, an dem Nietzsche laborierte und alle anderen Formen aktiver Schriftlichkeit) zum Sprechzeug, also der Präferenz für akustisch-sprachliche Mitteilungen in digitalen Medien, vor allem auf Social-Media-Plattformen. Zweifellos erfasst Christoph Engemann hier den momentanen Stand der Entwicklung sehr nachvollziehbar und weist auch auf deren Dynamik hin, zu der die rasante Entwicklung der KI beigetragen hat und beiträgt.
Das Buch will ich deshalb vor allem denen als Augenöffner empfehlen, für die »Lesen« im wesentlichen durch Buchlektüre definiert ist und die sich bislang maximal über die Differenz des Lesens von Texten auf Papier und auf Displays Gedanken machen. Ich möchte jedoch hier noch einige Anmerkungen machen. Es geht um Aspekte, deren Berücksichtigung ich erwartet habe, die jedoch im Buch nicht angesprochen werden.
Beispielsweise kann ich die Trennung von Schreiben und Lesen und die Fokussierung nur auf den rezeptionshistorischen Schwenk von der Lektüre zum Hören nicht nachvollziehen. Veränderungen auf der Erzeugungsseite sind in diesem Kontext doch zwingend. Schreiben für das Hören in digitalen Umgebungen unterliegt anderen Organisationsroutinen als das Schreiben für einsame Leser. Viele der mit oder ohne Bildbegleitung angebotenen Vorträge im Netz entstehen auf der Basis von Skripts, die viel stärker als ein traditioneller akademischer oder propagandistischer Vortrag dramaturgisiert sind und dabei häufig Raum für improvisierte Passagen lassen. So wird Authentizität generiert – ein Aspekt, auf den Christoph Engemann durchaus eingeht, den er jedoch nicht in den Kontext der Wirkungsmöglichkeiten auditiver Medien im Verhältnis zur einsamen Lektüre stellt. Auditive Medien vermögen viel mehr als Textmedien Identifikation zu erzeugen, zum Beispiel durch das emotionsbehaftete Fluidum des Stimmklangs. Ein Buchautor oder Kommentarschreiber ist nicht im gleichen Maße abwesend-anwesend wie eine Stimme, sei es über Kopfhörer oder in einem beschallten Raum.
Auch das Schreiben wird in digitale und automatisierte Routinen überführt, nicht nur das »Lesen« von sprachlichen Aufzeichnungen, die mit speech-to-text-Verfahren in Texte verwandelt werden, um Maschinen eine Zuordnung von Personenprofilen zu Inhalten und Menschen eine Suche nach audiovisuellen Inhalten zu ermöglichen. Es gibt dem Hörensagen nach kaum noch PR-Texte, vor allem wohl im B2B-Sektor, die von Menschen geschrieben werden. ChatGPT und andere Bots erledigen diese Arbeiten, ebenso schreiben sie vermutlich den allergrößten Teil der akademischen Referate und Abschlussarbeiten. Wie dem auf der Rezeptionsseite begegnet wird und künftig begegnet werden könnte, finde ich als jemand, der in dieser Hinsicht nicht mehr in der Pflicht ist, durchaus spannend.
Außerdem, und das scheint mir noch wichtiger zu sein, fehlt ein multimediales Format, das einen wesentlichen Teil nicht nur von Podcasts ausmacht, sondern immer schon das wesentliche Agens von Unterrichtung, also Lehren und Lernen, war: der Dialog. Die durch das Typographeum seit Ende des 15. Jahrhunderts vollzogene Abkehr von der mündlichen Unterrichtung wird durch die digitale Oralität revidiert, so könnte eine von Christoph Engemann nicht aufgestellte Behauptung lauten.
In einem 200.000-Zeichen-Essay können selbstverständlich nicht alle Aspekte einer komplexen historischen Entwicklung aufgespannt werden. Dennoch bin ich mit der im Schlussteil vorgenommenen Konzentration auf das Latein als sprachliche Grundlage der Gelehrsamkeit vor der Alphabetisierung breiter Schichten der Bevölkerung nicht ganz zufrieden. Es waren gerade die nicht-lateinischen Schriften, mit denen das Typographeum seine Wirkmacht entfaltete, beispielsweise die Anleitungen zur Geburtshilfe, zum Farbenmischen oder zum Bau von Destillieröfen. Gerade diese Schriften waren nicht nur nützlich zur beschleunigten Verbreitung von Wissensangeboten, sondern sie waren es auch, die im Typographeum die Ablösung der vorherigen Hegemonie des multimedialen Dialogs bei leiblicher Anwesenheit durch die monomediale Lektüre ermöglichten und erzwangen. Fortan galt nur das, was schwarz auf weiß geschrieben steht. Dass heute nun keine Bauanleitung mehr ohne Youtube-Video auskommt, kann als Schleifung der imperialen Macht des Druckwesens interpretiert werden, und somit auch als Gewinn für alle didaktischen Anliegen. Das Lernen im Dialog ist unstrittig weitaus erfolgversprechender als das einsame Lernen, und die audiovisuellen Lernangebote jenseits des öffentlich-rechtlichen Schulfernsehens sind offen für Nachfragen und Dialoge.
Ein zweites nicht erwähntes Feld ist die u. a. von Christian Benne (Die Erfindung des Manuskripts) untersuchte Schriftlichkeit der kaufmännischen und administrativen Prozesse, die bis ins 20. Jahrhundert hinein eine handschriftliche war und meist nicht ohne Anwesenheit der Kontrahenten ausgeübt wurde. Die Handschrift ist bei weitem nicht nur das Medium der Zertifizierung (durch Unterschrift). Benne weist darauf hin, dass die Handschrift und gedruckte Schrift nicht nur einen semiotischen Aspekt haben, sondern auch einen gegenständlichen. So war im 19. und 20. Jahrhundert geradezu eine kulturelle Aufwertung der Handschrift zu beobachten, die sich erst seit kurzem zu verflüchtigen scheint. Es galt die Norm, dass persönliche Mitteilungen, Gratulationen, Liebes- und Trennungserklärungen besser nicht in unpersönlicher Maschinenschrift übermittelt werden sollten. Auch wenn ein großer Teil dieser Kommunikationen heute als digitale Kurzmitteilungen einschließlich eingebetteter Audios und Videos stattfinden, zeigt der Boom des Marktes der Notizhefte und Schreibgeräte (Füllfederhalter!), dass das Handschriftliche noch lange kein Ende gefunden hat. Zu untersuchen wäre also die zunehmende Differenzierung der persönlichen Medien – auf beiden Seiten der Prozesskette, also der Erzeugung und der Rezeption von Mitteilungen. Ein »Audio an mich selbst« wird ein seltener Fall sein …
Eine wunderliche Eigenschaft des Buchs sind die vielen unkorrigierten Schreibfehler. Es gibt Doppelseiten mit vier oder fünf solchen Fehlern – wie kann das sein? Hat der Autor die Rechtschreibprüfung ausgeschaltet, hat der Verlag das Korrektorat eingespart? Außerdem gibt es manchmal elend lange Satzperioden, die sicher Mark Twain erfreut hätten (such das Prädikat!), aber die Lektüre erschweren – und übrigens auch nicht gut sprechbar sind.
Christoph Engemann: Die Zukunft des Lesens. Berlin: Matthes & Seitz Berlin, 2025.