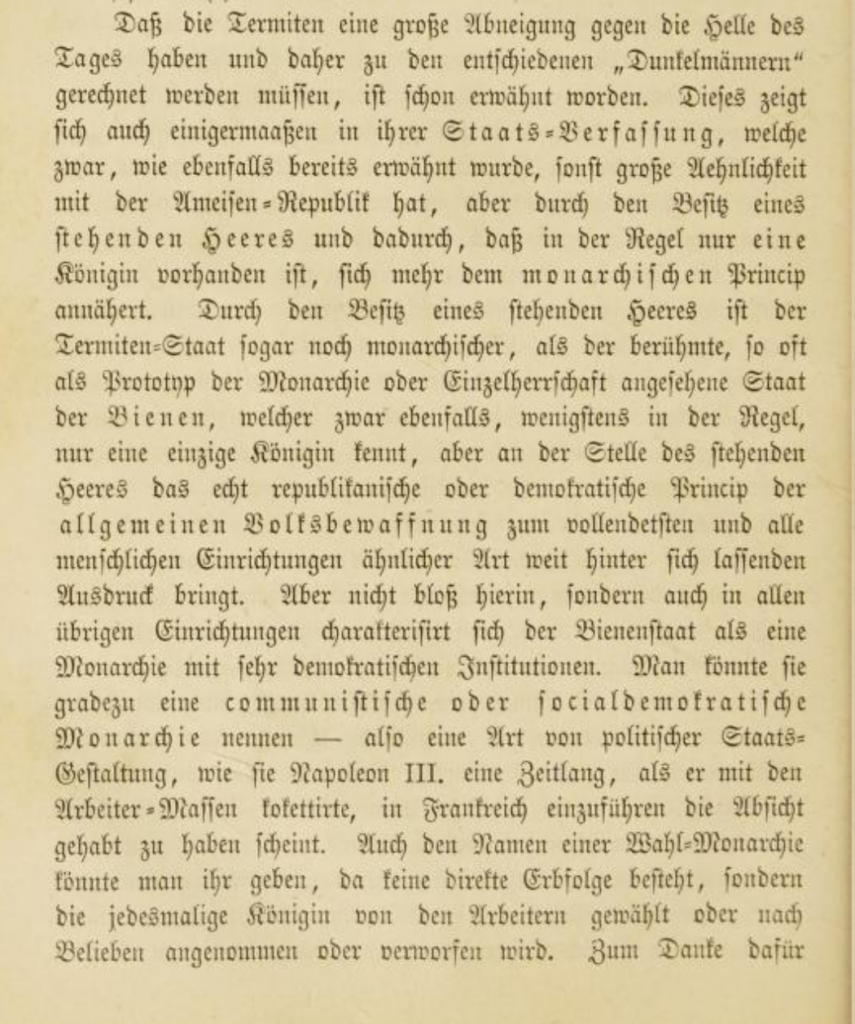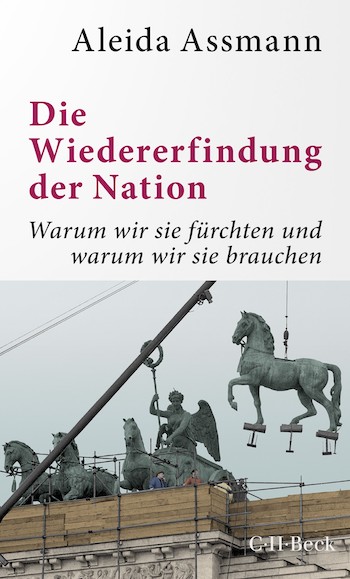Selbstverständlich bin ich kein Freund von Programm-Literatur. Ich las oder hörte irgendwo einen Hinweis auf Radka Denemarkovás Roman und entschloss mich, ihn zu lesen, weil ich glaubte, es sei ein multiperspektivisches Großwerk, zudem mit China befasst wie ich gerade auch. Die Erwartung vielfältiger Perspektiven erweist sich schnell als Illusion. Zwar ist fast jeder der vielen Abschnitte des Buchs einer Figur zugeordnet – die Schriftstellerin, der Programmierer, die chinesische Studentin, die amerikanische Studentin, der Diplomat, Olivie, Pommerantsch, um nur die wichtigsten zu nennen. Zuordnung bedeutet hier aber nicht Perspektive. Die Erzählperspektive ist immer dieselbe, eine Erzählerin erzählt die Personen und Dinge, der Leseprozess ist ein einziger Nachvollzug dieser einen Perspektive. Immer wieder gibt es allerdings Zitate – am häufigsten von Konfuzius und Václav Havel – und längere, vielleicht essayistisch gemeinte, aber eher doch als politische Pamphlete daherkommende Passagen. Diese finden sich besonders häufig in den Abschnitten, die dem Kater Pommerantsch zugeordnet sind – eine ausnehmend blöde Idee; es gibt sogar noch einen zweiten denkenden und sprechenden Kater.
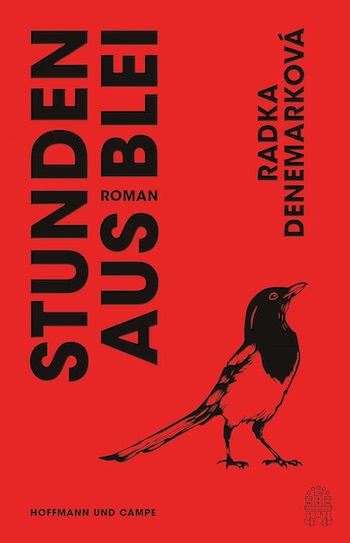
Die Autorin war einige Male in China und lernte dort, wie sie in einigen Interviews berichtet hat, eine Studentin kennen, die später aufgrund kritischer Äußerungen verhaftet wurde und offenbar in der Haft starb. Der Roman walzt diese Begegnungen und das Verschwinden der Studentin zu einer brutalen Tat aus, die in kurzen Episoden »enthüllt« wird: Die Studentin wird vom chinesischen Polizeitapparat gefoltert, ihr werden bei vollem Bewusstsein die Nieren entnommen, sie wird dann ermordet. Es gibt mehrere ähnliche Episoden über mordende staatliche Agenten, zum Beispiel diese:
Eine Greisin steht vor dem Parlament, sie schreit und droht mit dem Zeigefinger. Freundlich stellen sie sich zu ihr, ihre Stimmen reden sanft auf sie ein, natürlich lösen wir das Problem, kommen Sie mit, wir plaudern in Ruhe, Sie müssen nur ein Formular ausfüllen. Die Frau wird um die Ecke in einen grünen Kastenwagen geschoben, und unterwegs wird der Querulantin die Kehle durchgeschnitten. Das erfährt keiner.
Erklärungsansätze zur Sicht der Autorin auf die Verhältnisse in China gibt es nicht. Sie schickt ihre in Tschechien gewonnenen Einsichten und Haltungen sozusagen in den Krieg mit China. Denemarková bzw. ihre Figuren fordern vier Faktoren ein: Individualität, Freiheit, Menschenrechte, Demokratie. Ein Land, das diese Forderungen nicht erfüllt, ist für die Autorin nicht akzeptabel. Václav Havel, der sich ab 1968 kompromisslos für diese Faktoren einsetzte und als Mitinitiator der Charta 77 und nicht nur als Theaterautor weltweit bekannt wurde, steht für ein Muster des Widerstands, den sie in China vermisst. Statt Individualität zählen dort immer noch Familienwerte, statt um Menschenrechte geht es den meisten Menschen um »Business«, um Wohlstand. Bevor die chinesische Studentin durch ihre Gespräche mit der Schriftstellerin zu oppositionellen Äußerungen motiviert wird, wird sie so gezeichnet:
Für die junge Chinesin ist Mao ein Held, und die Geschäfte sind zum Bersten voll, zum Bersten voll. Die Augen sehen Waren. Von der jungen Chinesin und ihrer Generation kann man nichts erwarten.
Diese Diskrepanz zwischen den aus der Geschichte der Tschecholawakei gewonnenen Erwartungen und der von ihr wahrgenommenen Situation in China motiviert die Autorin zu einer 880-seitigen Predigt, mit Václav Havel als Lichtfigur, dessen Beispiel China erlösen könnte. Ihre Kritik entspricht dabei einer pauschalen und unterscheidungslosen Variante der Totalitarismus-Doktrin. Dabei ebnet sie die Verfolgung und Ermordung tschechischer Juden durch die Nazis, die Unterdrückung der antisowjetischen Opposition in der ČSSR und die umfassende Überwachung der Bevölkerung in China ein. Der chinesische »Totalitarismus« wird zudem vom postsowjetischen Tschechien und irgendwie auch vom ganzen Westen willfährig unterstützt. Statt dessen sollten alle Menschen guten Willens aufschreien oder zumindest nach dem Muster Havels unablässig Briefe schreiben …
Es ist nicht mein Anliegen, China oder irgendeine Institution auf der Welt, die Menschenrechte verletzt und keine Demokratie zulässt, zu verteidigen. Es gibt im Buch jedoch nicht den kleinsten Ansatz zur Erklärung des chinesischen Entwicklungsprozesses und auch keinen Versuch, die offenkundig in China dominierenden Traditionen zu verstehen. Sie stören die Autorin – die auch die chinesische Sprache nicht beherrscht – einfach, und allein das scheint für sie genug Legitimation für ihre Tiraden zu sein. Deshalb fängt sie mich mit solchen Sätzen, die sie einer ihrer Figuren in den Mund legt, nicht ein:
Ein alter Zyklus geht zu Ende. Die Welt strudelt. Eine Welt kastrierter Seelen. Es wird ein Krieg um die Menschlichkeit geführt. Nichts Geringeres steht auf dem Spiel. Das eigene Ich zu behalten gleicht heute einem Wunder. Überall nur Erfüller von Befehlen, Vorschriften, Anordnungen, Bekanntmachungen, Fragebögen, Formularen. Ihre Waffen haben sie gegen Druckspalten, Berichte und Denunziationen eingetauscht. Blicke nach China, bald lebt die ganze Welt so.
Ein einziges Mal gibt es eine gegenläufige Einsicht, der allerdings nicht weiter nachgegangen wird. Die Großmutter der ermordeten Studentin sagt, China zahle den Preis für die westliche Vorstellung vom Fortschritt. Diesen Gedanken würde ich gerne in den Kontext der chinesischen Geschichte stellen: Vo 1850 an hat das Land um seine territoriale Einheit gekämpft, gegen Kolonialmächte, Warlords, Invasoren und schließlich im Bürgerkrieg gegen opponierende politische Kräfte. Danach war es dazu verurteilt, Akteur in Systemauseinandersetzungen zu sein, unter anderem in Form einer Beteiligung am Koreakrieg und am Vietnamkrieg. Es musste verfehlte Entwicklungsstrategien wie den »Großen Sprung nach vorn« und die auf dessen Scheitern reagierende Kulturrevolution verkraften. Wen kann es da wundern, dass heute das Einheits- und Harmoniedenken von Konfuzius vorherrscht und vielen Chinesen eine Konfliktstrategie nach dem Muster Havels vielleicht nicht nur aus Angst vor der oppressiven Staatsmacht unattraktiv und unopportun erscheint?
Ich möchte keine Propagandaschriften in Romanform lesen, ob ich nun die Position ihrer Verfasser teile oder nicht. Aus Empörung und der Absicht, der anderen Seite »kompromisslos« die Meinung zu sagen, wird auch nie gute Literatur. In Denemarkovás Roman dienen viele Passagen nur dem Transport ihrer Polemik, die meisten Dialoge (es gibt offenbar Rezensenten, die sie als »sokratisch« bezeichnen) werden inszeniert, um die Überlegenheit einer Position, einer Haltung, einer Gefühlswelt hervorzuheben. Über die chinesische Studentin heißt es nach vielen Dialogen: »Zum ersten Mal begreift sie sich als Individuum«.
Die Übersetzerin Eva Profousová hat sich in einem Journal zur Übersetzung von Stunden aus Blei von Radka Denemarková geäußert:
https://www.toledo-programm.de/journale/3734/zwischen-log-und-tagebuch
Radka Denemarková: Stunden aus Blei. Hamburg: Hoffmann und Campe, 2022