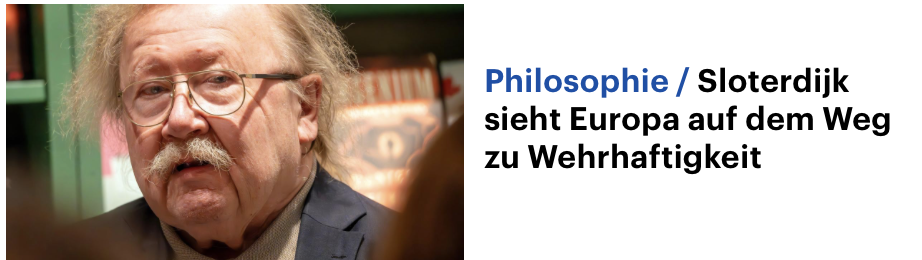Seit einigen Monaten lese ich zum »Herunterkommen« neben der eigenen Arbeit (eher: vor und nach) ein Buch nach dem anderen, das thematisch nichts mit meinem Thema, die Family Affairs der Booles, Taylors und Hintons, zu tun hat. In dieser kleinen Serie blicke ich auf einen Teil dieser Lektüre zurück.
Maryam Aras: Dinosaurierkind
Zwei Generationen iranischer Emigranten, die Tochter entdeckt ihren Vater in einem Film über die Proteste gegen den Schah-Besuch 1967. Der Vater lebt seit 1964 in Deutschland, er war ein Anhänger des Ministerpräsidenten Mossadegh, der 1953 aus dem Amt geputscht wurde. Vom britischen und amerikanischen Geheimdienst organisiert, brachte das iranische Militär den Schah an die Macht. Die Folge war die komplette quotenmäßige Kontrolle der iranischen Ölförderung durch amerikanische und europäische Konzerne. Mit ständigen Zeitsprüngen erzählt die Autorin das Leben ihres Vaters in Tehran und in Köln, über den langen Web seiner Einbürgerung und sein Studium in Deutschland – immer wieder gemischt mit Szenen aus dem Iran selbst, die Situation nach der islamischen Revolution der Ajatollahs 1979 und die Opposition auch gegen dieses neue Regime. Verwoben mit all diesen Geschichten und Berichten ist die eigene Biographie der 1982 in Deutschland geborenen Autorin, ihre Suche nach ihren familiären und kulturellen Wurzeln. Der Vater bringt an vielen Stellen des Buchs (eingerückt, kursiv) Anmerkungen und Korrekturen ein. Eine gelungene Montage, auch sehr informativ, und dem Vater, einem der »Dinosaurier« der ersten Generation der Iran-Emigration, kommt man beim Lesen sehr nahe.
Maryam Aras: Dinosaurierkind. Berlin: Claassen, 2025.