Was für ein Kontrast – zu den kürzlich gelesenen Büchern von Elminger, Edelbauer oder gar Schneider. Michal Ajvaz ist ein hierzulande unverständlicherweise unbekannter Autor. Seine Übersetzerin Veronika Siska ist gleichzeitig seine deutsche Verlegerin im kürzlich gegründeten Münchner Allee-Verlag.
Der Roman beantwortet in 22 recht kurzen Kapiteln die Frage seines Erzählers auf atemberaubend heitere Weise:
Ist es möglich, dass in unserer nächsten Nähe eine Welt existiert, die vor sonderbarem Leben überbordet, die vielleicht früher als unsere Stadt hier gewesen ist, und von deren Existenz wir überhaupt nichts wissen? [65]
Einen Vorschein dieser anderen Welt erleben wir vielleicht schon in unserem Alltag, wenn wir beim Putzen einen Schrank beiseite schieben »und plötzlich in das ironisch gleichgültige Gesicht seiner Hinterwand« [66] blicken. Der Ich-Erzähler gerät durch die Ausleihe eines Buchs, das er in einer Bibliothek entdeckt hat, in eine andere Welt. Es zog ihn durch seinen samt-violetten Einband und seine rätselhafte unbekannte Schrift an. Diese Schrift schien ein eigenes Leben zu haben, Lichteffekte, Bewegung und schließlich eine dreidimensionale Bildwelt zu entwickeln, eine Stadt in, hinter, unter oder neben dem ihm bekannten Prag. Ein Bibliothekar berichtet am nächsten Tag vom Einbruch einer anderen Welt in die eigene, erzeugt durch ausführliches Inspizieren desselben Buchs, und macht Andeutungen über einen geheimnisvollen und gefährlichen Flügel seiner Bibliothek, den er selbst nicht mehr betreten wolle. Und dann gerät der Erzähler selbst in den Nachtstunden immer wieder für eine gewisse Zeit, indem er neugierig rätselhaften Hinweisen folgt, in diese andere Welt hinein.
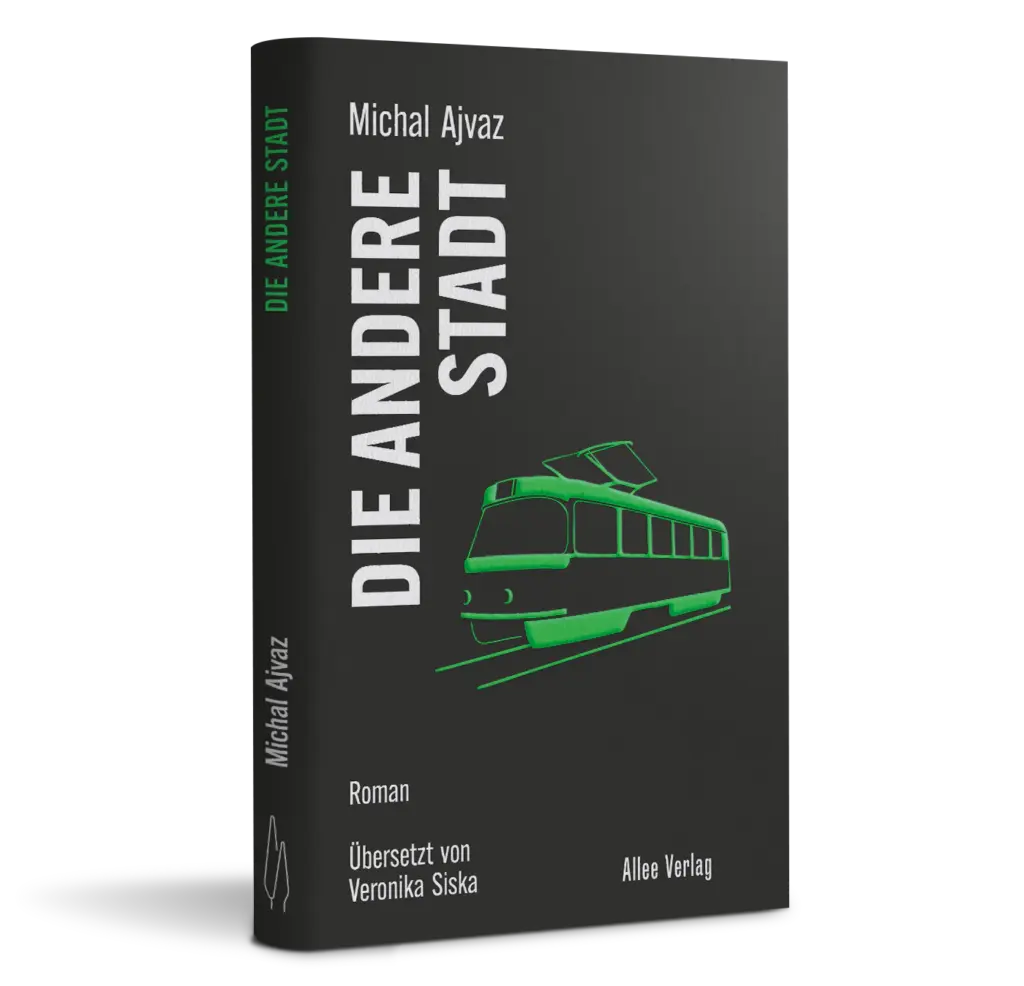
Ein Buch, dessen Schrift niemand entziffern kann – ist das nicht so etwas wie das Voynich-Manuskript? Dessen frühester dokumentierter Aufenthaltsort um 1600 war Prag. Eine normalerweise unsichtbare andere Welt, zu der es an geheimen Stellen Zugänge gibt – das erinnert an das Bukarest in Mircea Cărtărescus Roman Solenoid. Und da wir uns in Prag befinden, lässt sich eine Erinnerung an den Golem nicht vermeiden, wie er zum Beispiel von Gustav Meyrink dargestellt wurde.
Weitere Assoziationen kommen auf – zu Dantes Göttlicher Komödie, den Geschichten E. T. A. Hoffmanns und den in die vierte Dimension hineinreichenden Wissenschaftlichen Erzählungen Charles Howard Hintons, auch zu Alfred Kubins Die andere Seite, Hermann Kasacks Die Stadt hinter dem Strom und den Städten von Jorge Luis Borges. Paul Ernst hat mit der Erzählung »Die sonderbare Stadt« die Unheimlichkeit einer unterirdischen gläsernen Stadt ausgelotet. Nicht nur wegen des Sujets Stadt, sondern vor allem wegen der Leichtigkeit des sprachlichen Übertritts in eine parallele Welt ist zudem an Italo Calvino zu denken – Die unsichtbaren Städte, wo es neben etlichen anderen eine zweidimensionale Stadt gibt, die auf ein Blatt Papier passt und wie dieses eine Vorder- und eine Rückseite hat. Alle genannten Texte enthalten Grenzübertritte in phantastische Welten, in denen andere Gesetze herrschen als gewohnt und durch die auch die Selbstinterpretation der jeweiligen menschlichen Protagonisten zerfranst.
Für Fische, Wasser und Schnee scheint Michal Ajvaz eine besondere Vorliebe zu haben. Andere Welten, die hinter Gegenständen existieren und in Wohnungen umherkriechende Fische gibt es auch schon in seinen Gedichten und anderen Werken.
Es gelingt ihm mühelos, mit wenigen Sätzen bildstarke Eindrücke zu erzeugen:
Gehen die Bewohner der Wohnungen in der Nacht durch den dunklen Flur zur Toilette, ruht ihr Fuß manchmal kurz auf einem sich wiegenden Ponton: Nur wenige wagen es, über die schwankende Brücke in die Dunkelheit aufzubrechen, auch wenn viele wissen, dass sie an deren Ende ihren Namen vergessen und die Stirn an das kühle Metall der Rohrleitung legen dürfen, durch die die Milch verzweifelter Tiere in die phantastischen Küstenstädte strömt.
Die »andere Stadt« ist eine Art dreidimensionaler Spiegel der bekannten Welt, in der Menschen, Tiere und Gegenstände allerdings andere Beziehungen untereinander haben als gewohnt. In einer Passage fühlt man sich an E. T. A. Hoffmanns Nussknacker erinnert. In einem Geschäft, in dem tagsüber Schuhe und Socken verkauft werden, wird nachts eine Unzahl seltsamer Gegenstände angeboten. Eine selbständig agierende Schreibmaschine und belebte, sehr anhängliche Apfelscheiben sind noch die harmlosesten Objekte in diesem nächtlichen Kuriositätenkabinett. Es gibt auch Andeutungen einer gewissen Brutalität der traumhaften Wesen. Eine riesenhafte Ameise beißt einem jungen Mann nach langem Kampf den Kopf ab. Der Erzähler muss auf einem Kirchturm mit einem Hai kämpfen und kann ihn mit knapper Not besiegen. Andererseits erlebt er freundschaftliche Gefühle eines Rochens, den er davor bewahrt hatte, von einem Hund zerfleischt zu werden.
Die Stadt, die sich jenseits der physischen Grenzen der bekannten Welt ausbreitet, enthält auch Elemente einer wörtlichen »extended reality«: Der Erzähler lässt sich von einem Musikstück für siebenundfünfzig Pianisten berichten, »die an einer einzigen langgestreckten Tastatur spielen, die sich durch nächtliche Dörfer zieht und die im Mondschein in dunklen Obstgärten glänzt«. Er selbst fährt mit dem Fahrrad durch einen langen Tunnel, an dessen Wand 3.6oo Gemälde hängen, die sich jeweils nur durch geringfügige Permutationen unterscheiden, aber letztlich aufgrund ihrer Vielzahl Geschichten erzählen, in denen auch seine sonderbaren Erlebnisse enthalten sind.
Die ganze Stadt Prag ist voller Skulpturen, auch die Wohnungen und Läden. Der Erzähler entdeckt in einer Nacht, dass viele von ihnen hohl sind und beispielsweise als Ställe für kleine Elche genutzt werden.
Die »andere Stadt« hat einen eigenen Gott: Dargúz, und ein Nationalepos, aus dem (von einem Zitatenpapagei) eine Passage vorgetragen wird, es heißt »Der kaputte Teelöffel«.
Es ist aussichtslos, bei der Lektüre die Semantik der phantastischen Episoden entschlüsseln zu wollen. Das Schreiben selbst ist für Ajvaz – so sieht es im Nachwort der Slawist Tomáš Glanc – weniger ein Fixieren von Sinn als eine Möglichkeit, auf Sinngrenzen hinzuweisen, eine Art Oszillation zu erzeugen. Immer wieder geht es um die Abwehr von alltäglichen Sinnzuschreibungen, deren Funktion es sei, einer Begebenheit einen Platz im Gewebe der Beziehungen zuzuweisen, die insgesamt eine oder die »Heimat« bilden. Dazu erklärt der Erzähler – und benennt dabei gleichzeitig das, was er mit seinem Schreiben überwinden möchte: »Für uns existiert nur, was sich in die Spiele, die wir spielen, eingliedert«. Im Buch spielt die Schrift eine große Rolle, ein Widerschein der theoretischen Beschäftigung von Ajvaz mit Jacques Derrida, über den er zwei Bücher geschrieben hat. Im Roman findet sich der Satz: »Die Grammatik ist eine angewandte Dämonologie«, der Derrida gefallen hätte (falls er nicht überhaupt von ihm stammt).
Der Roman beginnt in einer Bibliothek, und in einer längeren, sich über zwei Kapitel erstreckenden Passage am Ende des Buchs ist diese Bibliothek der Ausgangspunkt einer langen Expedition in einen Bereich des Gebäudes, wo offenbar eine unsichtbare Grenze übertreten wird und sich die Bücher in den Regalen in eine »gefährliche und gleichgültige Vegetation« verwandeln. Der Erzähler begegnet den Gefahren mit zeichentheoretischen Reflexionen, die ihm letztlich auch die Abkehr von der sich perpetuierenden Regelhaftigkeit seines bisherigen Alltagslebens ermöglichen.
Eine kleine Leseprobe? Die folgende Passage enthält ein vom Erzähler belauschtes Gespräch zwei alter Damen in einem Café:
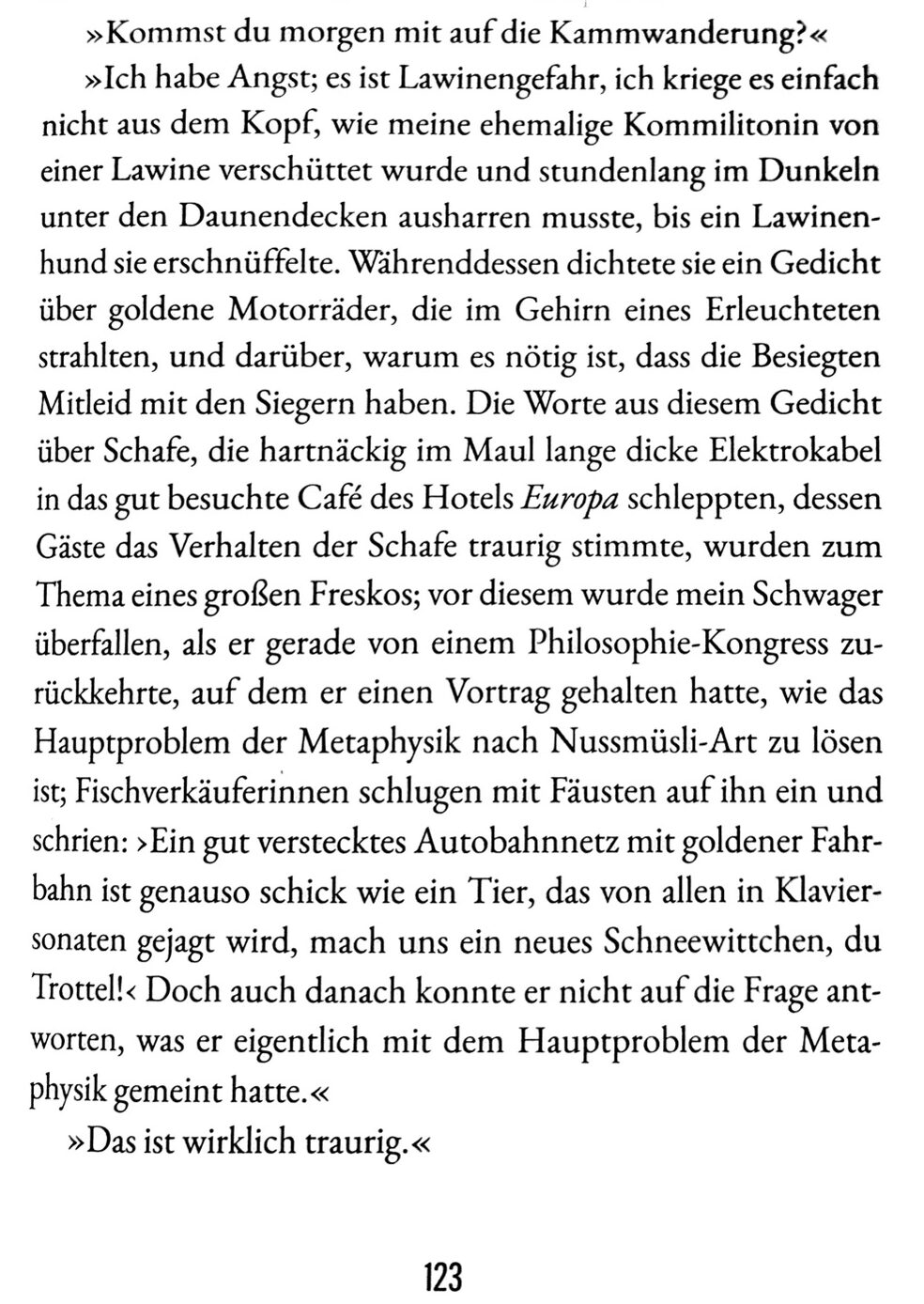
Jemand wie Michal Ajvaz fehlt in der deutschen Gegenwartsliteratur. Dieser fehlt es an Phantasie – und deshalb ist sie so wirklichkeitsarm.
Es ist mein Buch des Jahres (Abteilung Fiction).
Michal Ajvaz: Die andere Stadt. München: Allee-Verlag, 2025.