Nicht einfach nur weggelesen: zwei sprachskeptische und auf verschiedene Weise auch gesellschaftskritische Bücher junger deutschsprachiger Autoren. Elias Hirschl wird jetzt im Erscheinungsroman seines Romans 32, Gisela Elsner war 27, als ihr »Bericht« erschien.
(mehr …)Aktuelle Vergeblichkeitsforschung
-
Gottlose Kabbalistik – weltlose Texte
wie wenig machen wir uns klar, dass wir nicht an die welt, sondern die kommunikation grenzen. (Oswald Wiener)
Martin Warnke unternimmt in seinem in der schmalen Buchreihe »Fröhliche Wissenschaft« erschienenen Text eine Entdeckungsreise. Dabei berührt er die Geschichte der LLMs, selten beachtete linguistische Thesen, die Kabbala und die Übersetzungstheorie Walter Benjamins.

Einer seiner Einstiegspunkte ist die bei der Anwendung von KI-Chatbots derzeit noch häufig anzutreffende Erscheinung von »Halluzinationen«, syntaktisch korrekten, aber semantisch unsinnigen Aussagen. Ich selbst habe mir einmal ein Literaturverzeichnis mit den Schriften einer Autorin aus dem 19. Jahrhundert zusammenstellen lassen, in dem 40 Prozent der Titel frei erfunden oder dieser Person unberechtigerweise zugeschrieben waren. Obwohl im Effekt gleich, entstehen Halluzinationen völlig anders als menschliche Konfabulationen. Ich habe das Phänomen in mehreren Seminaren getestet: Eine halbe Stunde nach einer gemeinsam angesehenen TV-Nachrichtensendung wurde nur ein gutes Drittel der einzelnen Beiträge korrekt erinnert, häufig gab es Verwechslungen von Orten und Personen, und fast immer wurden auch hinzuerfundene Nachrichten aufgelistet. Das menschliche Gedächtnis spielt allen von uns aufgrund seiner Plastizität solche Streiche – es gibt keine festen und verlässlichen »Speicherplätze« für Erinnerungen. Bei der KI ist der Grund ein anderer, die Halluzinationen füllen probabilistische Lücken aus, weil es einen Mangel an Inputs oder an Überprüfungen durch Rückkopplungen gibt.
(mehr …) -
Immer wieder aufrecht
Wer beispielhaft studieren möchte, wie eine Familiengeschichte geschrieben werden sollte, die auch andere interessiert und nicht nur die Familie selbst, muss die Bücher von Lea Ypi lesen. Nach dem 2022 auf Deutsch erschienenen Buch Frei , das um den Angelpunkt des Jahres 1989 herum organisiert ist, rollt jetzt Aufrecht die Geschichte des 20. Jahrhunderts aus. Zentralfigur ist diesmal die Großmutter der Autorin, Leman Ypi. In drei chronologisch abgegrenzten Teilen wird die Familienchronik in die Geschichte Albaniens eingebettet. Einige Familienmitglieder haben in prominenten Funktionen auch daran mitgearbeitet, ein Urgroßvater, Xhafer Bey Ypi, war sogar von 1920 an mehrfacher Minister und Ministerpräsident und 1939 Staatsoberhaupt des Landes.
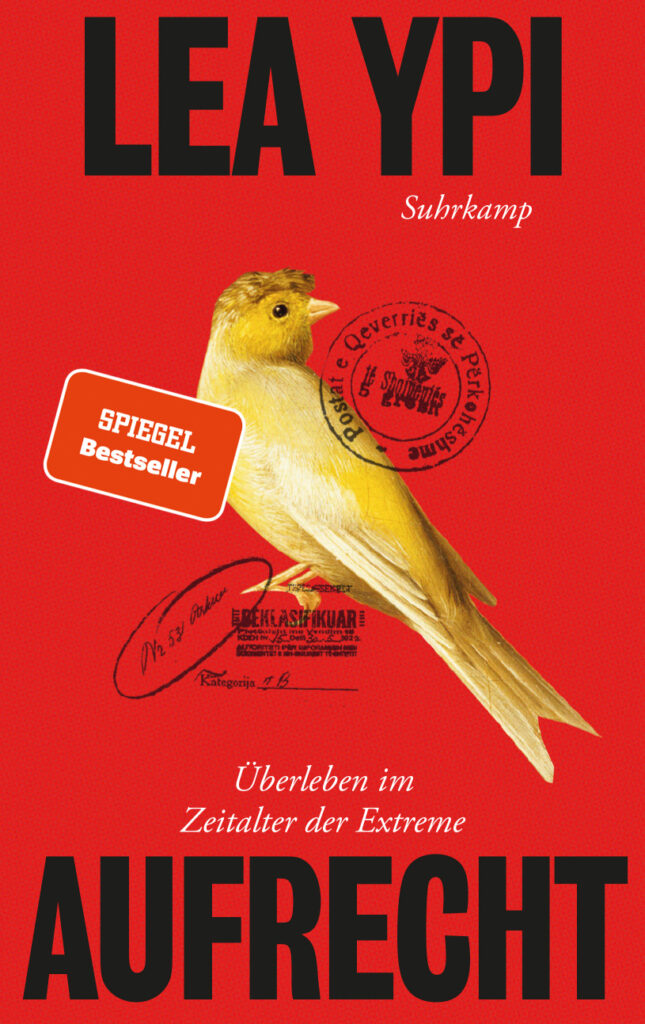
Was die Lektüre interessant macht, sind weniger die Daten und Fakten der allerdings sehr bewegten albanischen Geschichte vom Osmanischen Reich bis zur kommunistischen Despotie Enver Hoxhas, sondern die vielen erzählerischen Blitzlichter auf das Familiengeschehen. Häufig geht es um die Rechte und gesellschaftliche Position der Frauen. Die Erzählungen sind kein Beiwerk, sondern erzeugen erst ein Interesse an dem seltsamen Land, an seinen sozialen Innen- und Außenbeziehungen und letztlich auch immer ein wenig an der Autorin, die bekanntlich als Professorin für politische Theorie in London lebt.
Hier etwas nachzuerzählen kommt mir sinnlos vor. Das Buch gefällt mir, auch die sehr flüssige Übersetzung (aus dem Englischen).
Lea Ypi: Aufrecht. Überleben im Zeitalter der Extreme. Berlin: Suhrkamp, 2025.
-
Die Alarmierten
auch: Paranoia (6)
Michael Butter beschäftigt sich seit 2008 mit Verschwörungstheorien, habilitierte sich 2012 mit einer Arbeit über Verschwörungstheorien in den USA vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart und brachte 2018 ein weiteres, grundlegendes Buch über Verschwörungstheorien heraus.
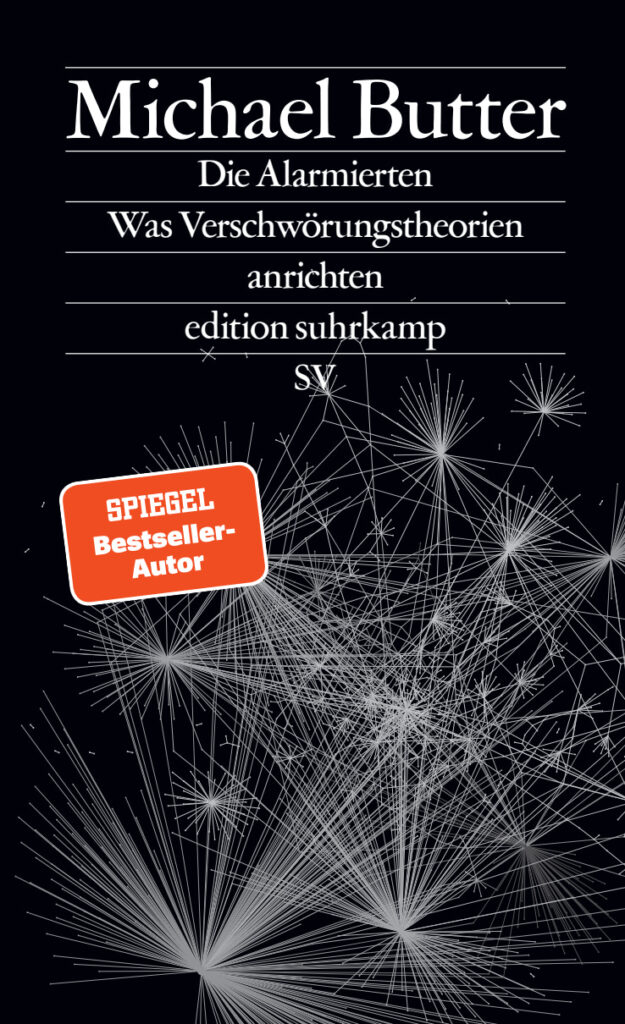
Seit der Covid-Pandemie sind Verschwörungstheorien in Deutschland ein häufiger Gegenstand von Spekulationen und Forschungen. Vielen Deutschen wird eine Neigung zu Verschwörungstheorien zugeschrieben – in manchen Studien zwischen einem Viertel bis zu einem Drittel der Bevölkerung. Butter hält die Zahlen jedoch für zu hoch gegriffen und etwa zehn Prozent für realistisch. Allerdings ist die Wirkmacht solcher Theorien in den USA sehr viel größer als in Deutschland, wo die Gesellschaft keineswegs so polar und tief gespalten ist. Anhänger von Verschwörungstheorien gehören hier eher zu den Außenseitern. Die öffentliche Wahrnehmung ist jedoch eine andere. Es findet, so nennt Butter es, ein »epistemischer Kollaps« statt.
In großen Teilen von Politik, Medien und Gesellschaft hat sich die Überzeugung durchgesetzt, Verschwörungstheorien stellten mittlerweile eine der größten Bedrohungen unserer Demokratie dar. Verschwörungstheorien werden häufig als per se antidemokratisch erachtet, als Katalysatoren für Radikalisierungsprozesse gesehen und als untrennbar mit populistischen, rechtsextremen und antisemitischen Überzeugungen verbunden begriffen. (13)
Kaum zu glauben, aber Butter hat nachgeforscht: In Deutschland gibt es mehr als fünfzig Projekte, größtenteils staatlich finanziert, zum Teil von privaten Stiftungen, die über Verschwörungstheorien aufklären wollen.
(mehr …) -
Paranoia der Gemeinschaft
auch: Paranoia (5)
Dabeisein ist alles. Die Politik des »Wir« reagiert auf den seit Jahrzehnten zu beobachtenden Bedeutungs- und Vertrauensverlust von Institutionen. In den ersten vier Jahrzehnten nach der Zerschlagung der NS-Herrschaft war der Erlebnisgehalt der Demokratie trotz tiefer Gräben zwischen den Parteien und Milieus hoch. Im 21. Jahrhundert sind starke Nivellierungstendenzen sichtbar, abgesehen von den unbearbeiteten Problemen der Eingliederung der DDR-Bevölkerung.
(mehr …)