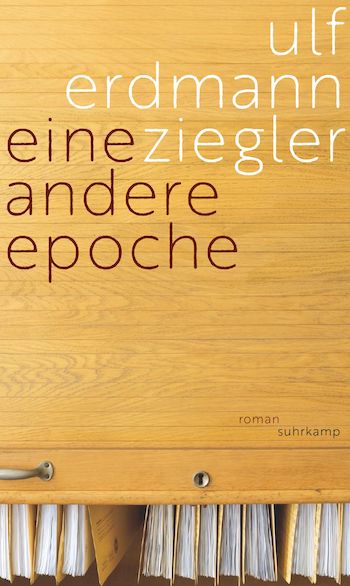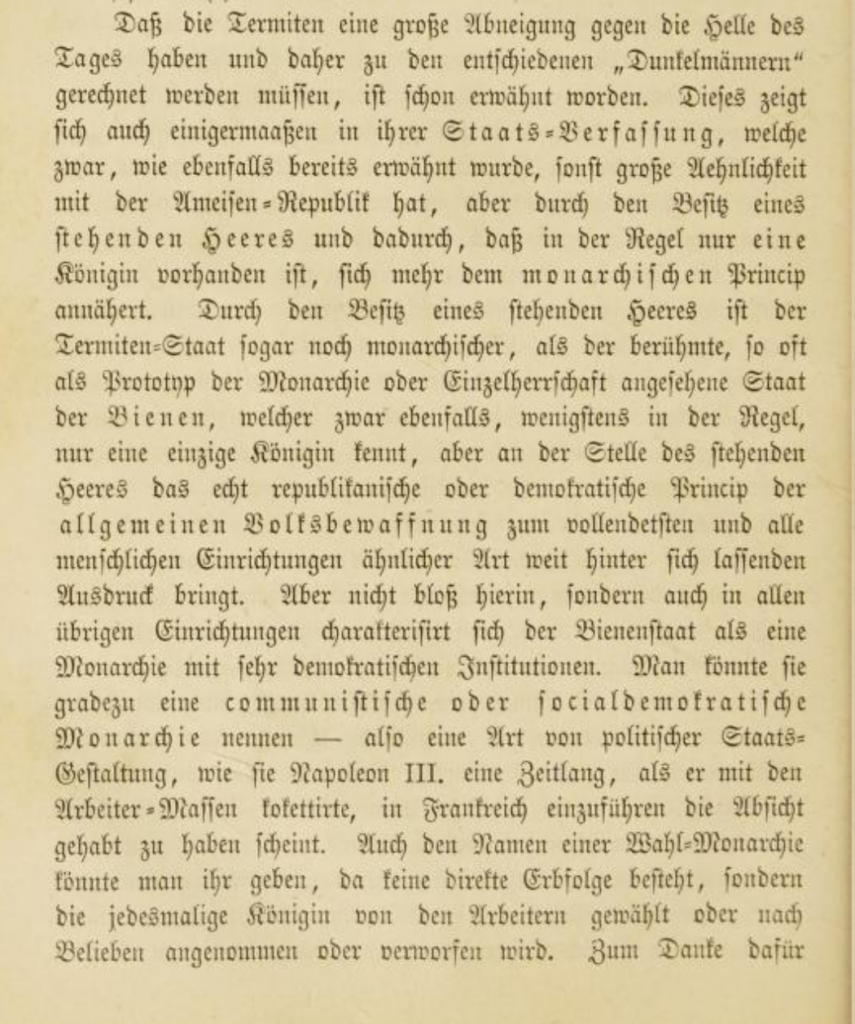Heute im Netto-Supermarkt. Irgendwo im Kassenbereich kräht ein Kind: »Ich will es aber haben«, schreit, brüllt minutenlang. Ich erreiche die Kassenschlange und sehe, was los ist. Großvater, Mutter und der sechsjährige Tom ringen um eine Kinderzeitschrift, irgendetwas mit Lego. Großvater hält den Jungen fest, während die Mutter das Heft ins Regal zurückbringt. Tom schreit wie am Spieß. Zwischendurch kurz einmal verständlich: »Ihr habt versprochen, dass ich das haben darf.« Er darf es nun doch nicht haben? Warum? Gebrüll, Wutanfall mit violett-rotem Kopf, Aufstampfen, klischeeartig, wie in einem schlechten Bilderbuch. Ich kann Mutter und Sohn unmittelbar nach draußen folgen, während der Großvater noch an der Kasse beschäftigt ist. »Du hast das Heft doch schon«, sagt die Mutter. »Ich will es aber haben, ihr habt es versprochen« – und ein weiterer Wutausbruch mit inzwischen schon heiserem Geschrei. »Im März gibt es das nächste, das bekommst du dann.« »Ich will es aber nicht im März, ich will es jetzt haben!« »Wir kaufen doch nicht das Heft zweimal, das Du schon hast.« – »Doch, ich will das jetzt haben.« Ein unlösbares Problem. Seine Familie versagt ihm das Glück des neuen Hefts, weil der Verlag die Periodizität seiner Kinderzeitschrift noch nicht an die Erwartungen Toms angepasst hat. Ich hätte es gern ausprobiert: Wäre Tom glücklich geworden, wenn er das Februarheft ein zweites Mal bekommen hätte?