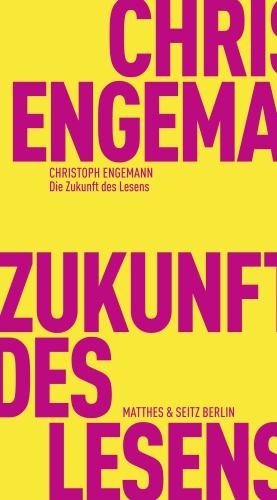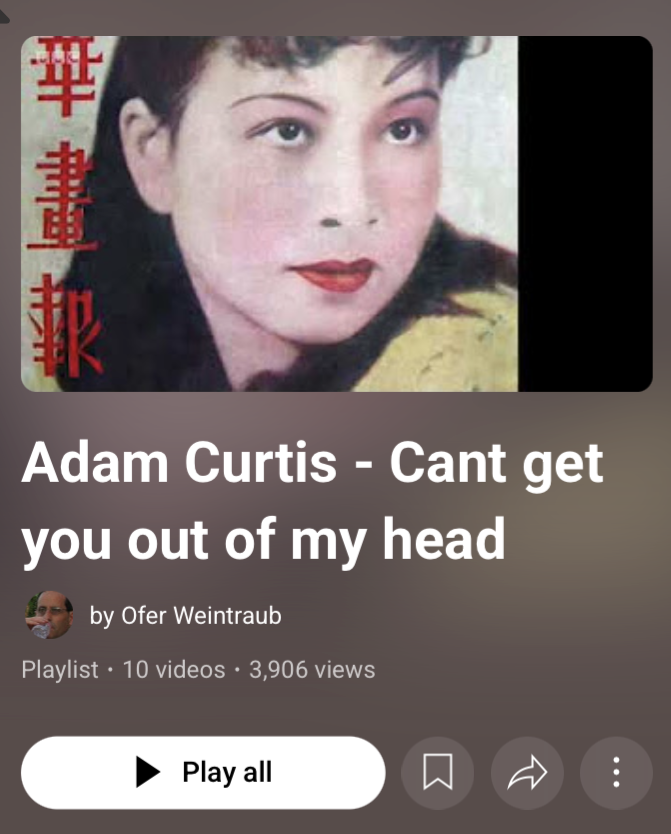auch: Paranoia (6)
Michael Butter beschäftigt sich seit 2008 mit Verschwörungstheorien, habilitierte sich 2012 mit einer Arbeit über Verschwörungstheorien in den USA vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart und brachte 2018 ein weiteres, grundlegendes Buch über Verschwörungstheorien heraus.
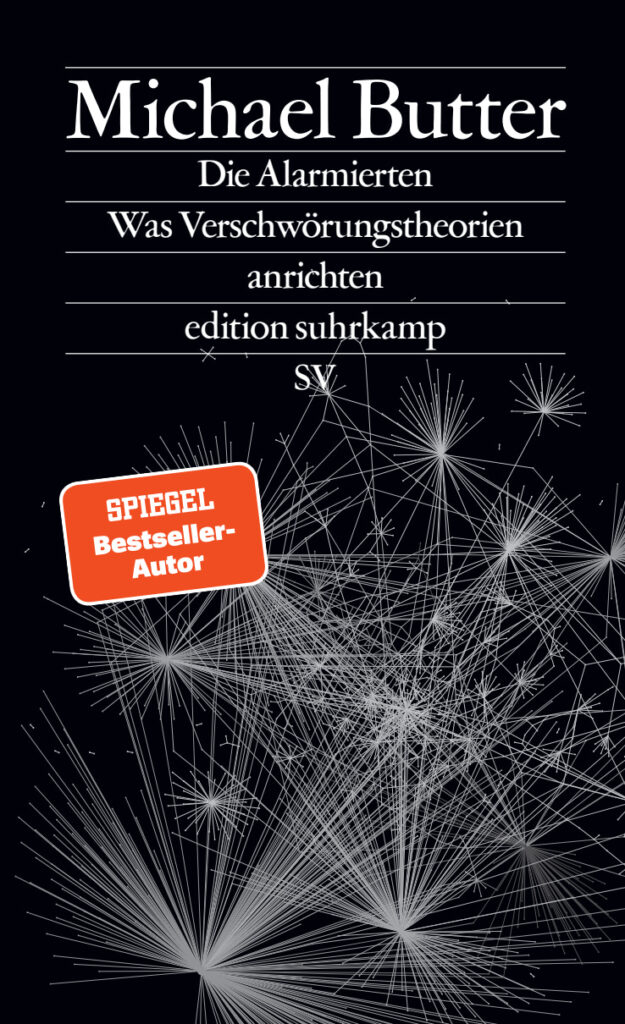
Seit der Covid-Pandemie sind Verschwörungstheorien in Deutschland ein häufiger Gegenstand von Spekulationen und Forschungen. Vielen Deutschen wird eine Neigung zu Verschwörungstheorien zugeschrieben – in manchen Studien zwischen einem Viertel bis zu einem Drittel der Bevölkerung. Butter hält die Zahlen jedoch für zu hoch gegriffen und etwa zehn Prozent für realistisch. Allerdings ist die Wirkmacht solcher Theorien in den USA sehr viel größer als in Deutschland, wo die Gesellschaft keineswegs so polar und tief gespalten ist. Anhänger von Verschwörungstheorien gehören hier eher zu den Außenseitern. Die öffentliche Wahrnehmung ist jedoch eine andere. Es findet, so nennt Butter es, ein »epistemischer Kollaps« statt.
In großen Teilen von Politik, Medien und Gesellschaft hat sich die Überzeugung durchgesetzt, Verschwörungstheorien stellten mittlerweile eine der größten Bedrohungen unserer Demokratie dar. Verschwörungstheorien werden häufig als per se antidemokratisch erachtet, als Katalysatoren für Radikalisierungsprozesse gesehen und als untrennbar mit populistischen, rechtsextremen und antisemitischen Überzeugungen verbunden begriffen. (13)
Kaum zu glauben, aber Butter hat nachgeforscht: In Deutschland gibt es mehr als fünfzig Projekte, größtenteils staatlich finanziert, zum Teil von privaten Stiftungen, die über Verschwörungstheorien aufklären wollen.
(mehr …)