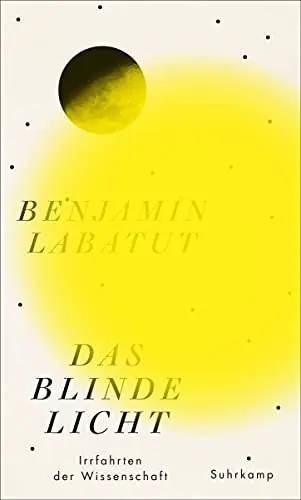Oren Kessler: Palästina 1936
Ein »großer Aufstand«, wie der Untertitel es andeutet, war es gar nicht. In Palästina gab es von 1936 bis 1938 eine Serie brutaler Gewalttaten, an deren Beginn der Autor Übergriffe arabischer Täter auf jüdische Bewohner in Jaffa und anderen Orten stellt. Auch die britische Besatzungsmacht, die den massiven Zuzug jüdischer Immigranten schützte, wurde punktuell attackiert. Es gelingt Kessler jedoch nicht, einen Aufstand von Palästinensern zu zeichnen, auch wenn er es vielleicht beabsichtigt hat. Das Buch besteht aus hunderten größtenteils unverbundener und folgenloser Kurzberichte über einzelne terroristische Akte beider Seiten, Kurzbiographien einzelner handelnder Personen (Palästinenser, Juden bzw. Zionisten, Engländer), alles in wechselnder Detailtiefe. Es scheint, als hätte Kessler alles, was in Dokumenten zu finden war, einfach ins Buch gekippt.
(mehr …)