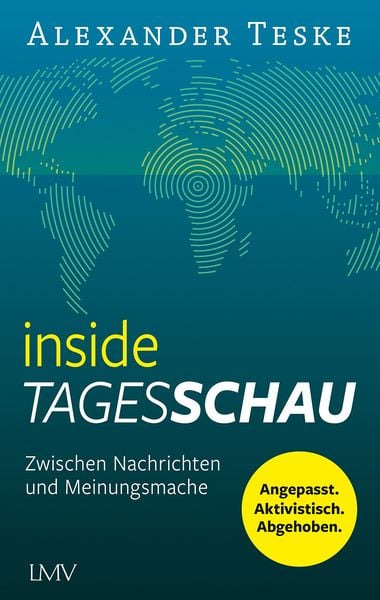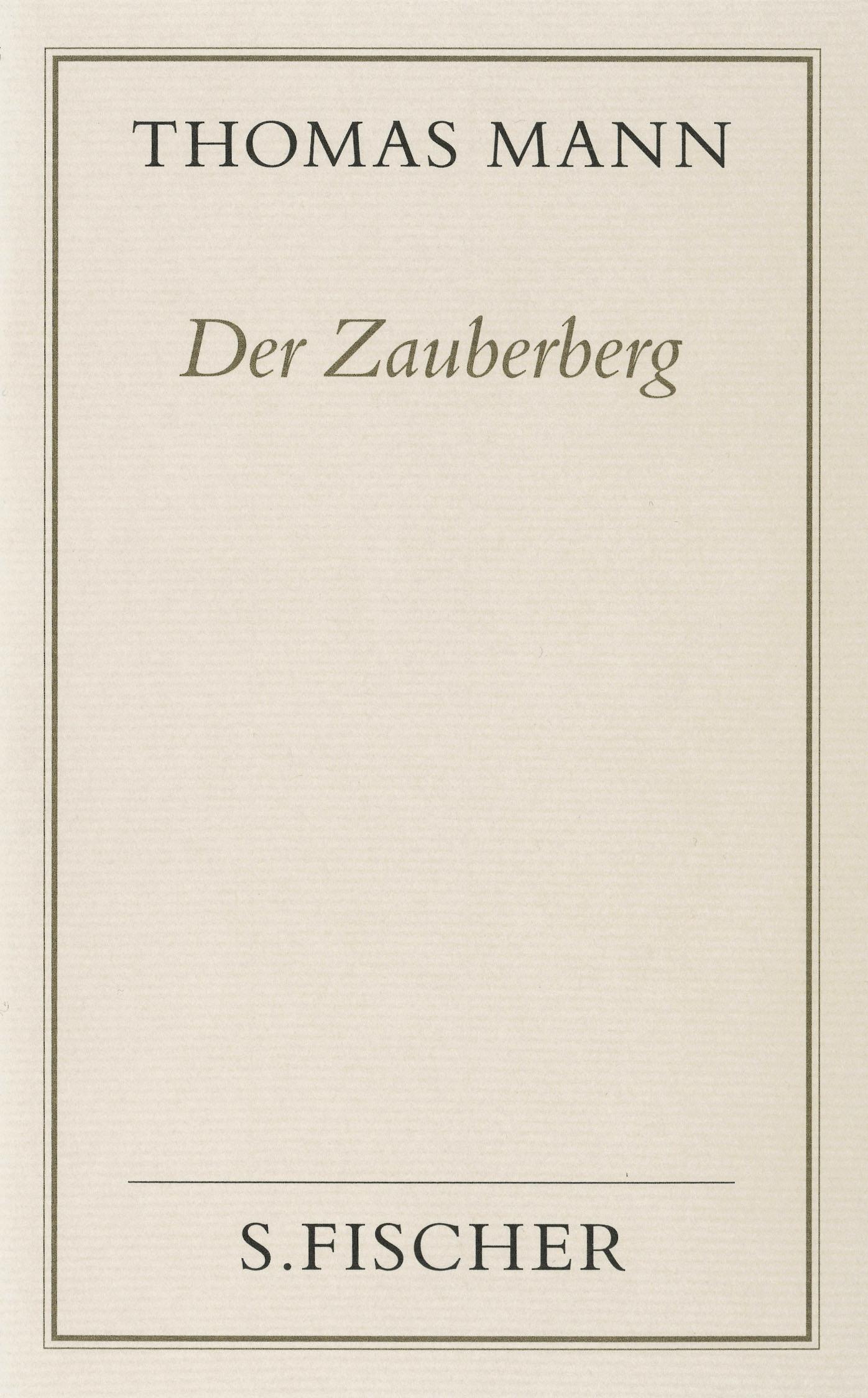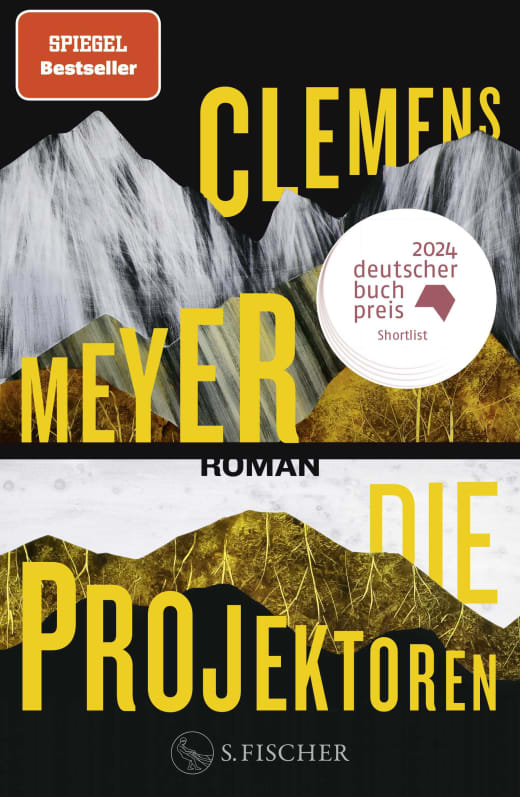Christina von Braun & Tilo Held: Kampf ums Unbewusste
Seit einigen Monaten lese ich zum »Herunterkommen« neben der eigenen Arbeit (eher: vor und nach) ein Buch nach dem anderen, das thematisch nichts mit meinem Thema, die Family Affairs der Booles, Taylors und Hintons, zu tun hat. In dieser kleinen Serie blicke ich auf einen Teil dieser Lektüre zurück.
Von den 730 Seiten hat Christina von Braun 498 geschrieben, ihr Mann Tilo Held 137, und 93 Seiten sind Anmerkungen und Register.
Die ersten 200 Seiten sind sehr erhellend. In ihnen wird beschrieben, wie in der Geistesgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts das Unbewusste an die Stelle Gottes rückte – und welche Ausgestaltungen das Unbewusste vor Freud und dann durch ihn und seine Zeitgenossen erlebte. Sie erfindet ein Gegensatzpaar – Glauben vs. Vertrauen –, deren Elemente sie wahlweise verschiedenen theoretischen Ausformungen zuordnet. Das funktioniert weitgehend gut mit dem Glauben, aber nach meinem Eindruck oft gar nicht gut mit dem Vertrauen.