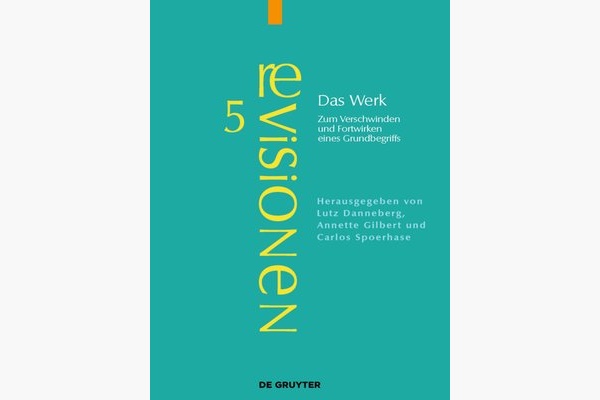Dieses Buch Dostojewskijs, dessen frühere Übersetzungen meist »Die Dämonen« getitelt waren, las ich jetzt zum ersten Mal. Es ist wider Erwarten eine sehr erheiternde Lektüre.
Der Text erschien 1871/72 zuerst in Fortsetzungen in einer Zeitschrift. Dostojewskij war zu der Zeit 50 Jahre alt. Er war als Spielsüchtiger hoch verschuldet, litt zudem an Epilepsie, lag in einem ständigen Kampf – vor allem mit sich selbst – um seinen Glauben und allgemein um Religiosität. Dabei versuchte er unentwegt, das »Russische« gegen die westliche Zivilisation und Kultur profilieren. Dennoch ist die Darstellungsweise des Romans über weite Strecken entspannt, distanziert, ironisch. Eine der Hauptfiguren, der seit Jahrzehnten von einer reichen Witwe ausgehaltene gescheiterte Schriftsteller und Dozent Stepan Trofinowitsch Werchowenskij, ist ein emotional und mental instabiler Hypochonder. Der Sohn der Witwe und Mäzenin, Nikolaj Wsewolodowitsch Stawrogin ist eine mindestens ebenso unausgeglichene Natur, zwischen Clownerie und Verzweiflung schwankend, extrem liberal auch in seiner Lebensführung, partiell Mitwirkender in revolutionären Zirkeln. Er kämpft um seinen Gottesglauben, übrigens nicht besonders überzeugend – hier kann der selbst an seinem Glauben zweifelnde Autor offenbar nicht über seinen Schatten springen. Die dritte männliche Hauptfigur ist der Sohn Werchowenskijs, Pjotr. Er ist der Organisator einer revolutionären Terrorzelle, die durch Brandstiftung und Mord einen Aufstand der Landbevölkerung initiieren will, ein durchtriebenes, gewalttätiges Chamäleon. Er verursacht schließlich Morde und Selbstmord in den eigenen Reihen; der Kampf gegen »Verräter« hat Vorrang vor den revolutionären Zielen. Dass die revolutionäre Bewegung, der diese Terrorzelle angehört, etwas mit der »Internationale« von Marx und Engels zu tun haben soll, deutet Dostojewskij zwar an, konkretisiert das jedoch nicht und scheint in dieser Hinsicht auch nicht sonderlich beschlagen oder interessiert zu sein. Ich konnte mich bei der Lektüre der Assoziation an deutsche K-Gruppen in den 1970er Jahren nicht erwehren. Das diktatorische Durchsetzen der »richtigen Linie« um jeden Preis, das Dostojewskij schildert, prägte und beschädigte auch deren Mitglieder (auch wenn es wohl nicht bis zum Mord getrieben wurde).
Drei Frauen stechen im Roman hervor: Die reiche aristokratische und herrschsüchtige Witwe Warwara Petrowna Stawrogina, die sich im ständigen Konflikt mit dem von ihr gepäppelten und auch bewunderten Intellektuellen Werchowenskij befindet, versucht bis zuletzt die Zügel in der Hand und die moralische Ordnung in ihrer Provinzgesellschaft aufrecht zu halten. Lisa, die schöne und kluge Tochter einer Generalswitwe, wird zum Spielball der Lügen und Intrigen, an denen aktiv Stawrogin und der junge Werchowenskij beteiligt sind. Eine von den Müttern erwünschte Heirat mit Stawrogin kann nicht zustande kommen, weil dieser sich vor Jahren bereits aus einer Laune heraus mit einer gehbehinderten und psychisch kranken Frau verheiratet hatte. Darja Pawlowna Schatowa, Tochter eines Leibeigenen und Zögling von Warwara Stawrogina, ist ebenfalls nur eine Spielfigur. Ihre von Stawrogina eingefädelte Ehe mit dem mehr als doppelt so alten Werchowenskij kommt wegen der moralischen Implikationen der Intrigen und Verwicklungen nicht zustande. Eine vierte weibliche Figur kommt erst später ins Spiel, Julija Michajlowna von Lembke, die Gattin des neuen Gouverneurs und eigentliche Fädenzieherin des politisch-gesellschaftlichen Geschehens in der Provinz, die deshalb auch von Pjotr Werchowenski in sein grausames Intrigenspiel eingebaut wird.
Der Roman ist ein schönes Beispiel für eine inkonsequente Erzählerposition. Hauptsächlich gibt es einen Ich-Erzähler, ein Freund des alten Werchowenski, der bei ihm täglich ein- und ausgeht. Er figuriert intra-diegetisch, greift also selbst hier und da in das erzählte Geschehen ein und gibt den Lesern gelegentlich auch Hinweise auf seine Erzählerrolle, indem er bei manchen Informationen explizit »vorgreift« oder sie in der Erzählordnung »verschiebt«. Es gibt aber auch einen Erzähler in der dritten Person, der in erlebter Rede allwissend darstellt, was der bei dem bestreffenden Geschehen nicht anwesende Chronist nicht miterlebt haben kann. Den Wechsel zwischen intra- und extra-diegetischem Erzähler vollzieht Dostojewskij ganz flüssig und fast unauffällig. Eine Identifikation mit irgendeiner der Romanfiguren ist schlechthin nicht möglich.
Etwas enttäuschend sind die Schlusspassagen. Die meisten Hauptfiguren werden durch verschiedene Todesarten kurzerhand abgeräumt. Ihr Bleiben wäre angesichts der kriminellen und moralisch unerträglichen Vorfälle schlecht begründbar gewesen. Unerträglich, so deutet Dostojewskij zumindest an, sind ohnehin die gesellschaftlichen Verhältnisse jener Jahre in Russland. Die Witwe Stawrogina setzt allerdings aufs Überleben, bloß nicht in ihrer Heimat, sie emigriert mit ihrer Pflegetochter in die Schweiz.
Die Übersetzung von Swetlana Geier verwendet ein modernes Deutsch und ermöglicht – ohne »glatt« zu wirken – das Eintauchen in den Strom des dargestellten Geschehens bei gleichzeitiger Distanz.
Fjodor Dostojewskij: Böse Geister. Aus dem Russischen von Swetlana Geier. Frankfurt am Main: Fischer, 2021.


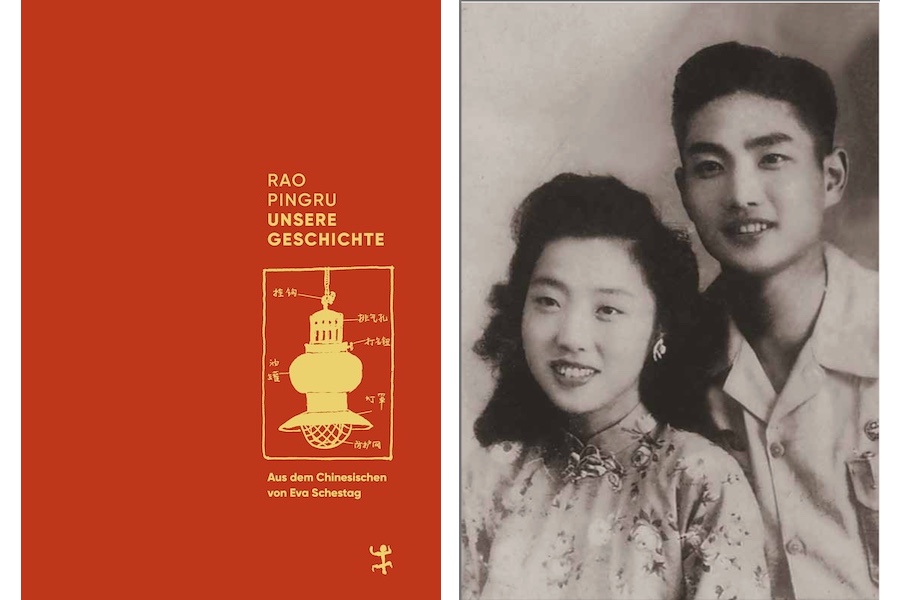




 Der junge Roger Tichbourne und sein Identitätsräuber Arthur Orton
Der junge Roger Tichbourne und sein Identitätsräuber Arthur Orton