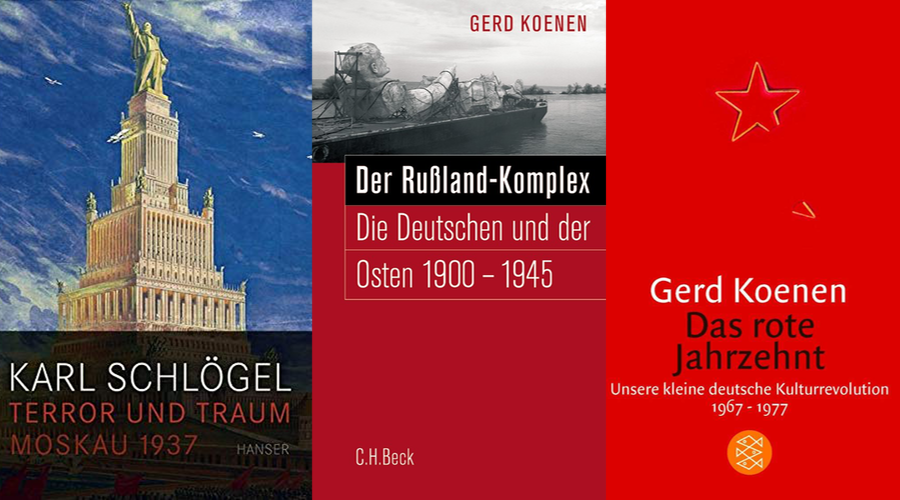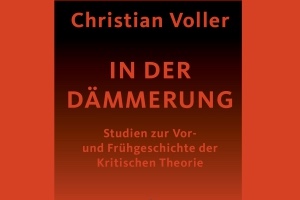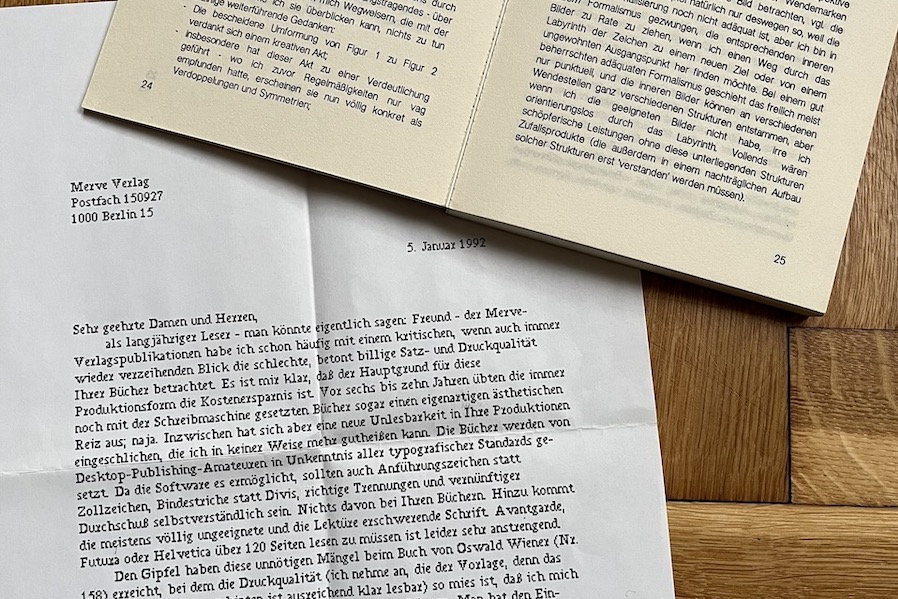Renegaten noch und noch: Friedenstauben werden zu Falken (wer hätte das bei Toni Hofreiter geahnt?), Marxisten-Leninisten zu Partnern der – wie sie damals sagten – »aggressivsten Fraktion des Monopolkapitals«, vormalig kritisch-analytische Geister zu penetranten Legendenverbreitern. Ich erkläre mir das unter anderem als Sehnsucht nach dem Eindeutigen, Richtigen, Unbezweifelbaren. Der Mainstream liefert diese Pharmaka nicht. Wie schon vor dem 1. Weltkrieg vergrößert sich die Verstörung auch kluger Geister, die irgendwie das Ganze zu fassen bekommen wollen, es aber nicht finden und formulieren können. Durch den Eintritt in einen geordneten Raum (autoritäre Parteiorganisationen, George-Kreis) und den Anschluss an geordnete Welterklärungen (Historischer Materialismus, Rassenideologien) konnte damals die Unruhe für zeitweilig gedämpft werden. Die aktuellen Überläufer zu den Querdenkern usw. haben – sofern sie eher meiner Generation angehören – oft eine Vergangenheit in kommunistischen Parteisekten. Da gibt es eine Gruppe, die zur Zeit erfolgreich den Mainstream vor sich hertreibt. Die fast kriegslüsternen Russland-Ukraine-Kommentare von Schlögel, Koenen, Fücks, Beck, Bütikofer et al. erinnern an ihre wüsten »antirevisionistischen« Schimpfkanonaden der 1970er. Dass es dabei nun zu Bündnissen mit der deutschen Waffenlobby (Strack-Zimmermann) kommt, stört sie überhaupt nicht. Die andere Gruppe ist schon vor einigen Jahren zur Achse des Guten, zu Tichys Einblick, zu den Nachdenkseiten und den noch eindeutigeren Foren und Gruppierungen übergelaufen. Dutzende früherer Linker (von Sponti bis ML) sind diesen Weg gegangen sind und geistern nun zum Teil bei den Identitären herum. Eine dritte Gruppe zieht offenbar aus DDR-Erfahrungen ähnliche Konsequenzen (Michael Meyen, Uwe Tellkamp).
Oft wird, vor allem von sozialdemokratisch geprägten Zeitgenossen, die »gemeinsame« Basis für die gesellschaftliche Kommunikation, Deliberation und Konfliktlösung beschworen. Sie sei durch spaltende Menschen und Medien bedroht, wenn nicht gar schon vernichtet worden. Der Sozialdemokratie ist die Arbeiterklasse als Massenbasis entschwunden – wobei ohnehin Zweifel an dieser Beschreibung angebracht sind –, und stellt nun fest, dass auch die »Mitte« aus vielen Partikularinteressen zusammengesetzt ist. Allerdings stimmt die Wahrnehmung des Verlusts der Gemeinsamkeit wohl gar nicht. Die gemeinsame Basis oder der gemeinsame Hintergrund der gesellschaftlichen Kommunikation wird in einigen Studien durchaus bestätigt. Das Informationsbudget auch der systemkritischen Gruppen enthält immer auch die Mainstream-Medien. Gerade diese Gruppen sind nicht Opfer einer Filterblase, sondern wählen selbstbewusst Informationsquellen aus. Ebenso sind Echokammern ihre aktive Wahl, diese bestätigen ihnen (zumindest vermeintlich) die ersehnte Selbstwirksamkeit.
Mit der Darstellung von Algorithmen als Täter und Mediennutzern als Opfer (besonders spezialisiert darauf hat sich Carsten Brosda, ein schlimmer medienrechtlicher Unterstützer dieser Sicht ist Rolf Schwartmann) wollen sich Medienpolitiker und Institutionen wie die Landesmedienanstalten die Legitimation für ihr Regulierungshandeln verschaffen. Zu beobachten ist das bei Social Media, jetzt auch bei ChatGPT. Ich halte das in manchen Auswüchsen (Schwartmann will die Metas und Alphabets zu einer »zweiten Säule« von Klickvorschlägen verpflichten, die den staatlichen Vorstellungen von Ausgewogenheit entsprechen) für geradezu demokratiegefährdend. Brosda äußert sich gerade wieder in der FAZ: Zwar wüsste momentan noch niemand, ob und wie die KI die öffentliche Kommunikation verändern wird, aber wir stehen hier an »Kipppunkten«, unsere demokratische Souveränität ist in Gefahr, vor allem durch chinesische KI-Angebote. Welche das sind, um welche konkreten Auswirkungen es gehen könnte usw., führt Brosda nicht aus. Ihm ist offenbar vor allem wichtig, ein erregendes Thema gefunden zu haben, mit dem die Regulatoren die Öffentlichkeit mobilisieren können. Die China-Keule passt einfach überall.
Die von Sunstein, Pariser und anderen auf anekdotischer Basis heraufbeschworenen Erscheinungen finden eigentlich nur bei einer Gruppe von Mediennutzern einen Grund: den Nur-Fernsehern der Seniorenklasse. Die kennen die Welt nur noch aus den Heute- und Tagesschau-Nachrichten und können sich wunderbar darüber austauschen, welche Farbe das Kleid von Annalena Baerbock bei ihrem G7-Auftritt hatte. Die Angemessenheit der Weltsicht, die über die Fernsehnachrichten vermittelt wird, scheint mir ein wesentlich wichtigeres und auch Erregung verdienendes Thema zu sein als Phantastereien über den chinesischen Einfluss auf die hiesige Meinungsbildung.
Foto: Senator Carsten Brosda ©Hernandez für Behörde für Kultur und Medien Hamburg