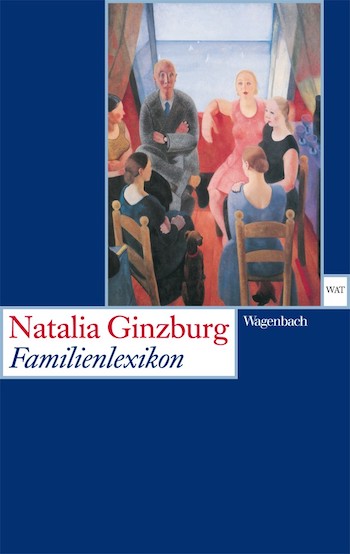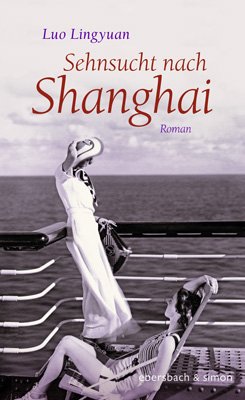
Ein enttäuschendes Buch. Shanghai war 1935 eine vom Kolonialismus gezeichnete, »internationale« Stadt, in der westliche Großmächte Konzessionsgebiete besaßen und Japan schrittweise an Einfluss gewann. Zeitweilig galt Shanghai neben oder noch vor Paris als Boheme-Metropole, und 1938 bis 1940 strömten jüdische Emigranten aus Deutschland und Europa in die Stadt. Die Koexistenz und Verbindung von westlichen und chinesischen Lebensstilen – dazu, für manche, auch der leichte Zugang zu Opium – zog intellektuelle Nomaden an, zu denen auch die amerikanische Bergbau-Ingenieurin und Journalistin Emily Hahn (1905–1997) gehörte. Sie lebte von 1935 bis 1943 in China.
Ein Blick auf die Karte (empfehlenswert die Navigation, mit der sich Veränderungen über die Zeit darstellen lässt) zeigt, dass China absolut zerrissen war. Abgesehen von einigen durch die Sowjetunion besetzten Landesteile gab es große Gebiete, in denen Clans und Warlords herrschten, dazu kam im Nordosten das von Japan eroberte »Mandschukuo«. Seit 1927 herrschte Bürgerkrieg zwischen Teilen der Kuomintang unter Chiang Kai-shek und den Kommunisten unter Mao Zedong, der nach dem Langen Marsch 1934–35 zunächst an Heftigkeit verlor. Für Chiang Kai-shek hatte jedoch auch in den Folgejahren, in denen Japan auf weitere Teile Chinas zuzugreifen begann, die Vernichtung der Kommunisten die absolute Priorität gegenüber der Verteidigung Chinas gegen die Invasoren.
In dieser Situation kam Emily Hahn nach Shanghai. Luo Lingyuan, eine chinesische, auf Deutsch schreibende Autorin, erzählt in ihrem biographischen »Roman« vor allem die Liebesgeschichten und das private Leben ihrer Protagonistin nach. Diese hatte eine Dauer-Liebschaft mit dem jungen Lyriker und Verleger Zau Sinmay und wurde schließlich sogar dessen Zweitfrau. Zau hatte mit seiner chinesischen Frau insgesamt neun Kinder, während sich der permanent thematisierte Kinderwunsch von Emily Hahn in dieser Beziehung nicht erfüllte.
Hahn schrieb viele Artikel für den New Yorker und in Shanghai erscheinende chinesisch- und englischsprachige Zeitungen. Über den Inhalt dieser Arbeiten erfahren die Leser des Romans nichts. Nur über das Zustandekommen des Reportagebuchs The Soong Sisters wird ausführlich berichtet. Die drei Schwestern, die in den USA studiert hatten, waren in China äußerst einflussreich. Die älteste, Ai-ling, war mit dem damals reichsten Mann Chinas verheiratet, H. H. Kung. Die mittlere Schwester Ching-ling heiratete den Gründer der ersten chinesischen Republik, Sun Yat-sen, der allerdings schon 1925 starb. Sie blieb nach dessen Tod politisch aktiv, trat für den Zusammenschluss der Kuomintang mit den Kommunisten ein und erhielt von 1949 bis zu ihrem Tod 1981 höchste Staatsämter in China, zweimal war sie auch Staatsoberhaupt. Die dritte Schwester, May-ling, wurde Ehefrau des Kuomintang-Führers Chiang Kai-shek. Sie übte angeblich einen moderierenden Einfluss auf den immer diktatorisch gesonnenen Militär und Politiker aus, der nach der Niederschlagung der Kuomintang in China von 1945 bis 1975 in Taiwan herrschte. Nach seinem Tod zog May-ling (»Madame Chiang Kai-shek«) nach New York, wo sie 2003 (mit 106 Jahren) starb.

Ein in Hongkong 1997 produzierter Film über die Soong-Schwestern (mit Maggie Cheung als Ching-ling) behandelt einige Episoden Ende der dreißiger Jahre, die Emily Hahn auch miterlebte. Der Film ist interessant, wenn wegen der dürftigen Informationsqualität der Hahn-Biographie ohnehin eine historische Recherche und Vergewisserung stattgefunden hat.
Einige Bücher (von 54 erschienenen!) Emily Hahns lohnen sicher die Lektüre, darunter das über die Soong-Schwestern, ein historischer Rundschlag (China Only Yesterday 1850–1950. A Century of Change) und China to Me, das viele Beiträge aus dem New Yorker enthält. Ein vielleicht lohnenderes Buch über Emily Hahn als das von Luo Lingyuan ist das von Taras Grescoe: Shanghai Grand: Forbidden Love and International Intrigue in a Doomed World, erschienen 2016.
Ein Zitat aus Luos Buch. Als Emily Hahn mit ihrem Geliebten und einigen chinesischen Freunden eine Wanderung in einer gebirgigen Gegend unternahmen, wird »erlebte Rede« eingesetzt:
Die Chinesen sind wirklich zäh, dachte sie. Die werden es noch weit bringen. (S. 59)
Und den H-Punkt (dazu hier) markiert diese Liebeserklärung (S. 90): »Deine Nase ist so perfekt geformt und göttlich wie eine Drachengalle.«
Luo Lingyuan: Sehnsucht nach Shanghai. Berlin: Ebersbach & Simon, 2021