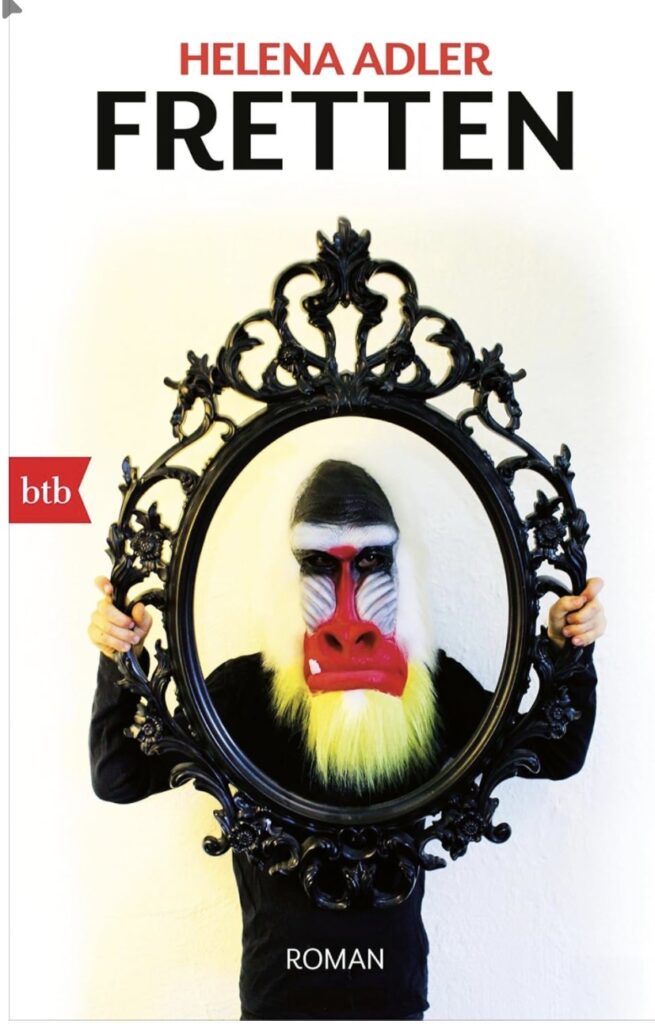Christoph Engemann beobachtet und beschreibt seit vielen Jahren Besonderheiten der digitalen Medienwelt – spontan erinnere ich mich an Themen wie digitale Identität, die »Verschränkung« von Maschinen und Körpern und das von ihm in die Diskussion über digitale Netzwerke und Plattformen eingebrachte Stichwort »Graphennahme«. Bei letzterem geht es um die Datenstrukturen, die in Netzwerken jeden einzelnen Nutzer und jede einzelne Aktion als dynamische Relation aufzeichnen, um sie für die Plattform-Betreiber, also Graphen»nehmer«, kommerziell und für andere Zwecke nutzbar zu machen. Die ersten Leser aller Schreibakte auf einer Plattform sind die graphengenerierenden Maschinen. Schreibakte sind dabei jedoch nicht nur schriftliche Hervorbringungen von menschlichen Individuen, sondern auch Audio- und Videoströme, die automatisch und hinter dem Rücken der Akteure in Texte übersetzt werden – und manchmal als automatische Transkripte z. B. bei Youtube auch für Nutzer sichtbar werden.
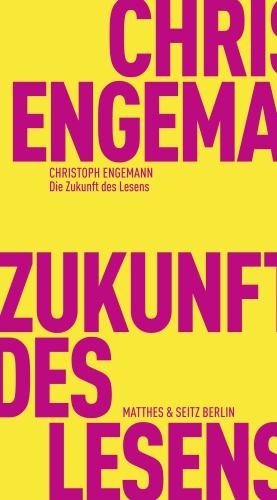
Das zentrale neue Schlagwort des Buchs ist die »Plattform-Oralität«. Beschrieben wird damit der Übergang vom Schreibzeug (das Dispositiv Schreibmaschine, an dem Nietzsche laborierte und alle anderen Formen aktiver Schriftlichkeit) zum Sprechzeug, also der Präferenz für akustisch-sprachliche Mitteilungen in digitalen Medien, vor allem auf Social-Media-Plattformen. Zweifellos erfasst Christoph Engemann hier den momentanen Stand der Entwicklung sehr nachvollziehbar und weist auch auf deren Dynamik hin, zu der die rasante Entwicklung der KI beigetragen hat und beiträgt.
Das Buch will ich deshalb vor allem denen als Augenöffner empfehlen, für die »Lesen« im wesentlichen durch Buchlektüre definiert ist und die sich bislang maximal über die Differenz des Lesens von Texten auf Papier und auf Displays Gedanken machen. Ich möchte jedoch hier noch einige Anmerkungen machen. Es geht um Aspekte, deren Berücksichtigung ich erwartet habe, die jedoch im Buch nicht angesprochen werden.
(mehr …)