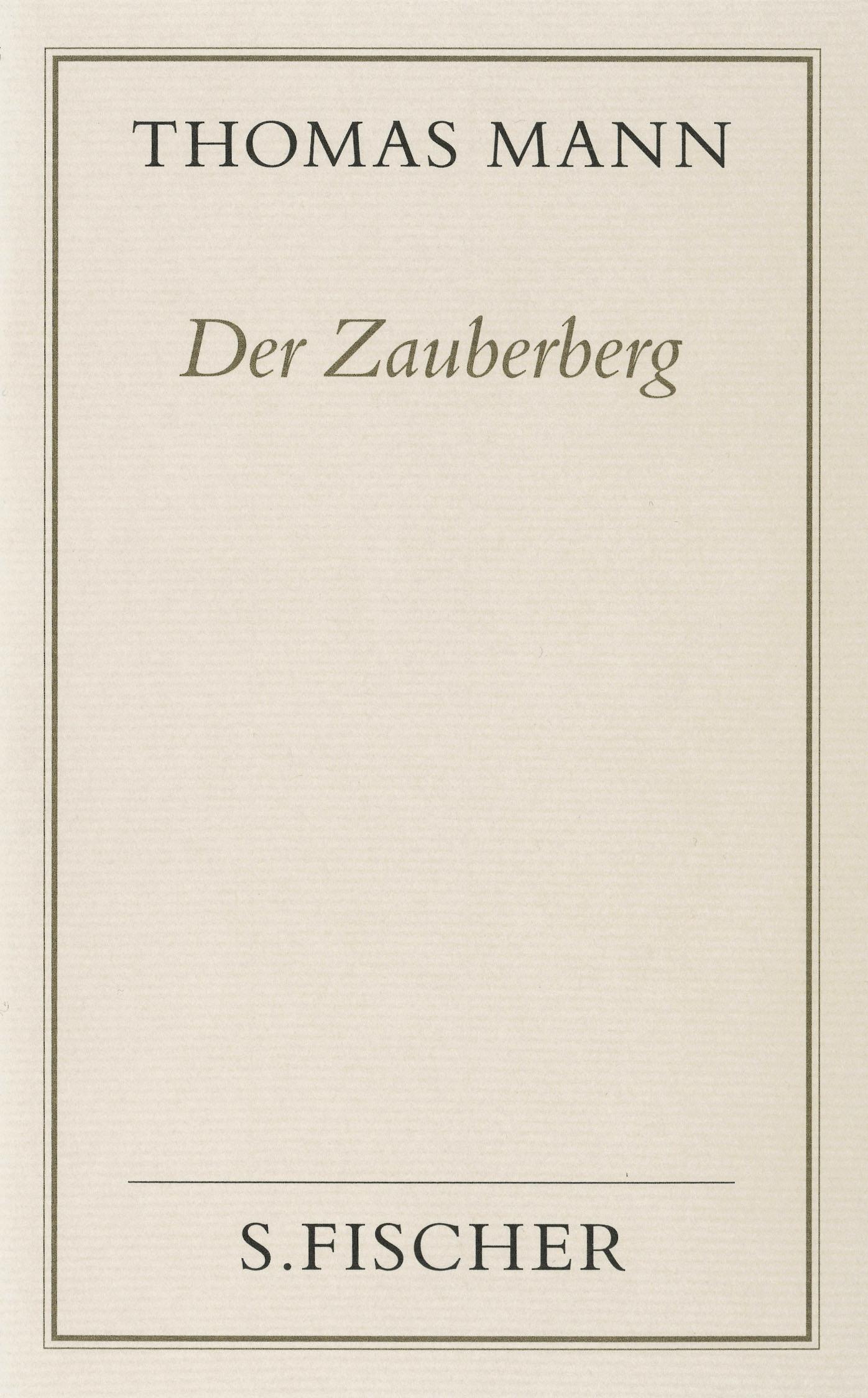Richard Hofstadter
Viele der heutigen politischen Weltbeschreibungen deutscher Politiker und Journalisten erinnern an die Weltsicht der amerikanischen Rechten, die 1963 auf beeindruckende Weise von Richard Hofstadter, The Paranoid Style in American Politics, beschrieben wurde. Auch Franz Neumann, Angst und Politik 1954 sowie Leo Löwenthal, Falsche Propheten 1949 hatten dazu schon erhellende Analysen gemacht. Es ist erstaunlich, dass sich so wenig an den Denk- und Argumentationsmodellen der US-Rechtsextremen geändert hat. Trump benutzt Textbausteine, die teilweise wortwörtlich schon in den 1950er Jahren verwendet wurden. Die genannten sozialpsychologischen Analysen legen auch Erklärungen nahe, warum das Verschwörungsdenken in den USA immer wieder mehrheitsfähig war und ist.
Warum der Begriff Paranoia?
I call it the paranoid style simply because no other word adequately evokes the qualities of heated exaggeration, suspiciousness, and conspiratorial fantasy that I have in mind (…) the idea of the paranoid style would have little contemporary relevance or historical value if it were applied only to people with profoundly disturbed minds. It is the use of paranoid modes of expression by more or less normal people that makes the phenomenon significant.
Paranoide Äußerungen und Strategien in der Politik imaginieren systematische feindselige und verschwörerische Angriffe auf die Nation, die Kultur, die Lebensweise aller Menschen. Ein Beispiel Hofstadters: Nach der Ermordung John F. Kennedys gab es eine Gesetzesintiative zur Einschränkung des Waffenverkaufs. Dagegen erhob sich aggressiver Protest. Das sei der Versuch einer subversiven Macht, die amerikanische Nation einer sozialistischen Herrschaft zu unterwerfen, Chaos zu erzeugen und ihren Feinden zur Machtergreifung zu verhelfen. Ähnliche Reaktionen gab und gibt es auf die Fluoridierung des Trinkwasser.
(mehr …)