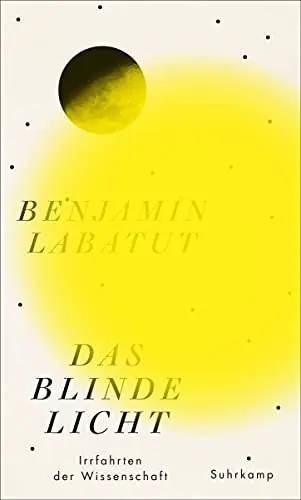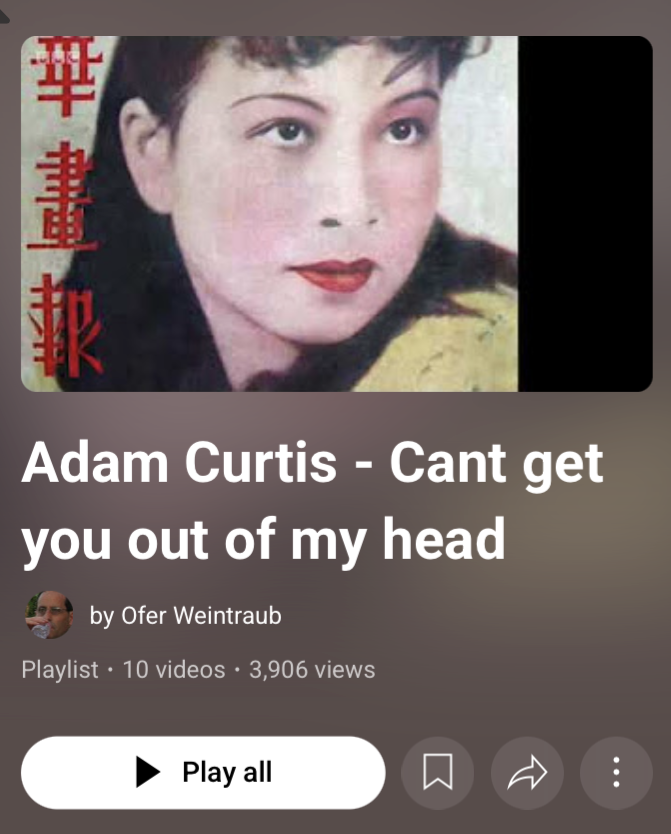
Adam Curtis, der britische Dokumentarfilmer, hat in seiner über 8 Stunden dauernden Serie Can’t get you out of my head verschiedene Aspekte der Paranoia und von Verschwörungsphantasien aufgegriffen. Er beginnt mit Jim Garrison, dem Staatsanwalt, der das Attentat an John F. Kennedy untersuchte. Er sah hinter der Tat eine Verschwörung, eine art deep state, also ein hinter den offiziellen Institutionen wirkendes zweites, mächtiges System.
Die Person von Jiang Qing, der letzten Ehefrau Mao Zedongs, beschäftigt Curtis in der Serie immer wieder. Seine These: Mao ließ sie unberaten los, um die Massen im Sinne seiner Linie aufzurühren – aber auch ohne die Chance, die Massen wieder zurückzurufen. Sie geriet nach einem Machtwechsel als Angehörige der Viererbande ins Gefängnis und erhängte sich dort nach zehn Jahren an zusammengeknoteten Socken.
(mehr …)