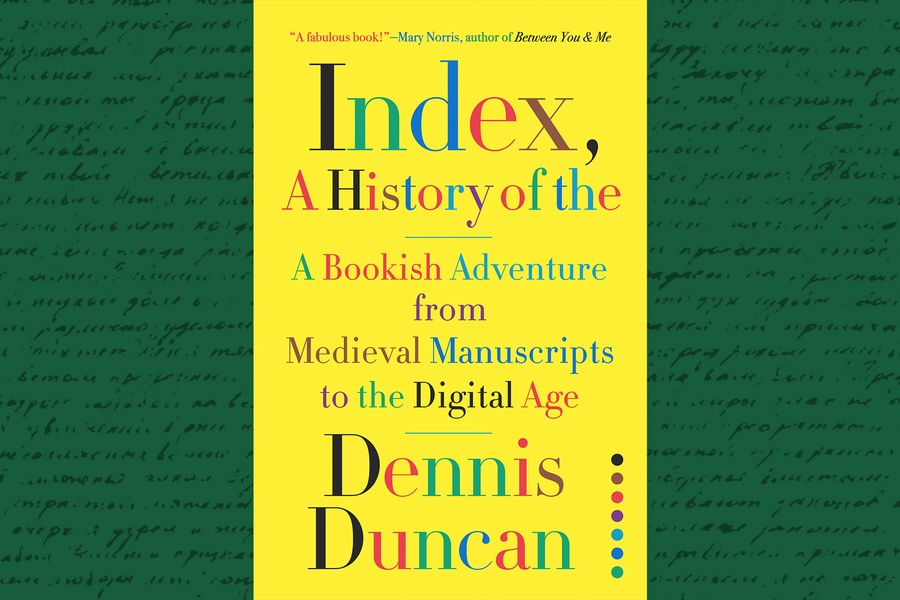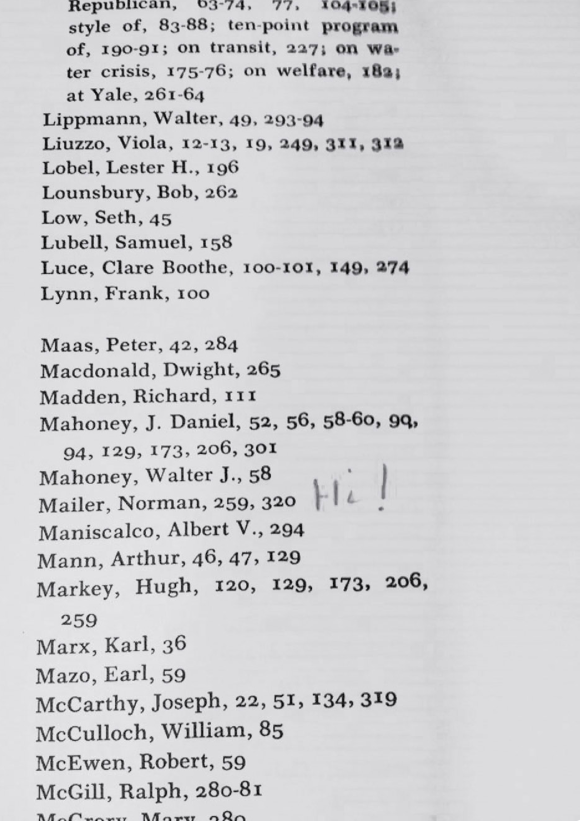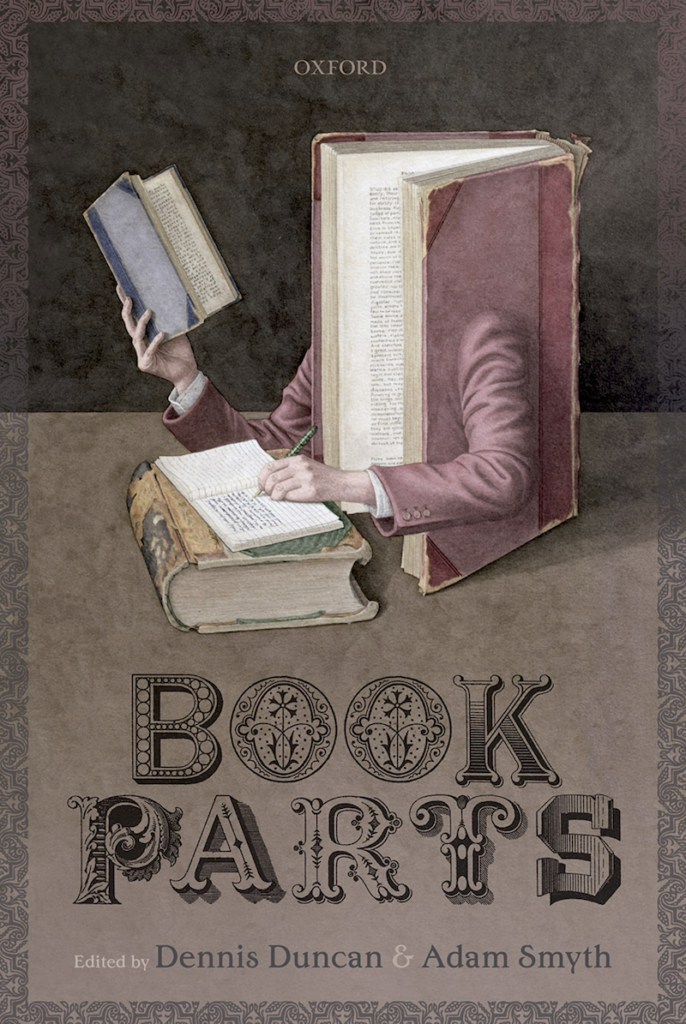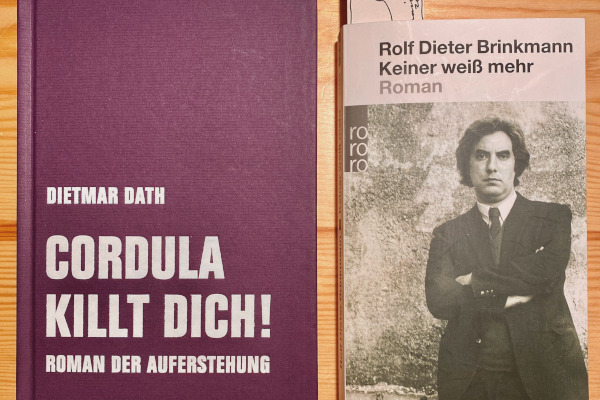Ein Buch für Wissende und Unwissende gleichermaßen. Esel figurieren in der historischen Alltagskommunikation, in literarischen und philosophischen Texten oft als dumm, störrisch und indolent. Ihnen wird absurderweise ihre Langohrigkeit vorgeworfen (Nietzsche betont deshalb das kleine Format seiner eigenen Ohren), zudem ihr passiver Widerstand. Dass Esel in Gefahrensituationen stehenbleiben, ist keine Dummheit, sondern für Tiere, die im Gebirge auf Geröll herumlaufen, lebensrettend. In der Verächtlichmachung von Eseln durch Legenden wie die von Buridans Esel, der unentschieden zwischen zwei Heuhaufen verhungert, steckt offenbar immer eine heimliche Bewunderung der Lebenskraft dieser Tiere. Diese wird in manchen Mythen und Fabeln nicht nur angedeutet, sondern von Lukian bis Shakespeare auch drastisch beschrieben.
Esel sind keine fehlerhaften Pferde, wie eine ausführliche und kritische Lektüre der Schriften von Buffon bis Darwin ergibt. Buffon erkannte, dass Esel und Pferde getrennte Arten darstellen, weil die aus Kreuzungen hervorgehenden Tiere (in der Regel) nicht fortpflanzungsfähig sind. Da Gott keine Fehler begeht, muss er Esel wohl als eigenständige Art geschaffen haben. Die Nobilitierung dieser Tiere durch Jesus, der auf einer Eselin nach Jerusalem einreitet, spricht zudem für sich. Durch Darwin wird klar, dass sich Esel und Pferd zueinander verhalten wie Menschen und Menschenaffen: sie haben gemeinsame Urahnen.
Dass Nietzsche sich nicht nur als Antichrist, sondern auch als Antiesel bezeichnet, ist nicht völlig verzeihlich. Die Autorin merkt auch an, dass es ihm besser gestanden hätte, wenn er in Turin einen Esel umarmt hätte statt ein klappriges Pferd.
Der Esel ist der Bartleby unter den Tieren – das arbeitet Jutta Person sehr gut heraus. Seine Haltung ist nicht einfach passiv, sondern in ihrer Passivität produktiv. Sie macht deutlich, dass dem Esel die Alternative nicht genügt, sich entweder zur Wehr zu setzen oder einfach weiterzumachen. Der Esel ist ein Zauderer, der gegen eine binäre Entscheidungslogik opponiert und somit auch der Zweckhaftigkeit allen Verhaltens eine Absage erteilt.
Das Buch kann als Reflexionsgrundlage zu einem Jahresbeginn nur empfohlen werden. Im Anhang finden sich Angaben über die verschiedenen Eselrassen. Überdies ist Esel reich bebildert.
Franz Kafka: Tagebuch 28.10.1911
Ich träumte heute von einem windhundartigen Esel, der in seinen Bewegungen sehr zurückhaltend war. Ich beobachtete ihn genau, weil ich mir der Seltenheit der Erscheinung bewußt war, behielt aber nur die Erinnerung daran zurück, daß mir seine schmalen Menschenfüße wegen ihrer Länge und Gleichförmigkeit nicht gefallen wollten. Ich bot ihm frische, dunkelgrüne Zypressenbüschel an, die ich eben von einer alten Züricher Dame (das Ganze spielte sich in Zürich ab) bekommen hatte, er wollte sie nicht, schnupperte nur leicht an ihnen; als ich sie aber dann auf einem Tisch liegen ließ, fraß er mir sie so vollständig auf daß nur ein kaum zu erkennender kastanienähnlicher Kern übrig blieb. Später war die Rede davon, daß dieser Esel noch nie auf Vieren gegangen sei, sondern sich immer menschlich aufrecht halte und seine silbrig glänzende Brust und das Bäuchlein zeige. Das war aber eigentlich nicht richtig.
Filmstill mit Catherine Deneuve aus dem Film Peau d’âne (1970). R: Jacques Demy.
Jutta Person: Esel. Fünfte Auflage. Berlin: Matthes & Seitz, 2019